Der Ikea-Effekt
Wenn aus Arbeit Liebe wird

Kartons aufreißen, Bauteile sortieren, Schrauben zählen: So beginnt ein DIY-Nachmittag nach einem Vormittag bei Ikea. Dass wir dort gern einkaufen, liegt am demokratischen Design und den günstigen Preisen – möchte man meinen. Eine Studie einer amerikanischen Forschergruppe hat eine weitere Theorie: Die Menschen bauen ihren Besitz gern selbst zusammen – und schätzen ihn danach als wertvoller und liebenswerter ein.
Als in den Fünfzigerjahren die Fertigprodukte in die Haushalte einzogen, sollten sie vor allem eines tun: die Hausfrau von lästiger Hausarbeit befreien. Es war das Zeitalter der Automatisierung und Elektrifizierung. Während die Hausfrau Vorwerks Kobold über den Wohnzimmer-Teppich zog, um die Toast Hawaii-Krümel der gestrigen Dinnerparty aufzusaugen, kümmerte sich die Waschmaschine um die Wäsche, der Mixer um den Keksteig, der Elektroherd um den Eintopf. Die Rationalisierung von Arbeitsprozessen war ein neuer Mitbewohner in den Nachkriegshaushalten. Doch in einem Punkt kamen die Effizienzbestrebungen an ihre Grenzen: Als in den USA die ersten Instant-Backmischungen auf den Markt kamen, verweigerten die Hausfrauen den Kauf. Rückfragen bei den Konsumentinnen ergaben, dass sie das Backen zu einfach aussehen ließen und das Können, Wissen und die Arbeitsleistung der Bäckerinnen entwerteten. So bediente man sich bei den Herstellern eines Tricks. Eier- oder Milchpulver wurden den Mixturen entzogen und die Anleitung enthielt Eigenleistungen: Das Ei musste aufgeschlagen werden oder eine Tasse Milch hinzugefügt, einige Kuchen forderten plötzlich aufwendige Dekorationen. Eigentlich hatten die Hersteller aber im ersten Rezept nur eine andere wichtige Zutat vergessen: die Arbeit.

Arbeitsleistung als Ressource
Erst im Jahr 2011 gaben Michael Norton, Dan Ariely und Daniel Mochon dem Phänomen einen Namen: „Der Ikea-Effekt“. Sie zitierten das Fertigkuchen-Gate der Fünfziger, um das Erfolgsmodell des schwedischen Möbelhauses zu erklären. Die veröffentlichte Studie mit dem Subtitel „When labour leads to love“ belegt anhand von mehreren Experimenten, dass Güter, in die Verbraucher*innen selbst Arbeit investiert haben, eine höhere Wertschätzung erfahren. Die Forscher ließen dafür Proband*innen einfache Aufbewahrungsboxen von Ikea zusammenbauen und fragten sie danach, wie viel sie dafür bezahlen würden. Eine Vergleichsgruppe erhielt hingegen die Möglichkeit, die Boxen fertig montiert zu erwerben. Die Bau-Gruppe bot im Durchschnitt 63 Prozent mehr als die Konsument*innen-Gruppe. Im Bauprozess hatten die Monteur*innen eine emotionale Bindung zum Produkt entwickelt und ihre Arbeit als eine in das Produkt investierte Ressource hinzugerechnet. Norton, Ariely und Mochon schließen aus den Ergebnissen, dass durch die lange Auseinandersetzung Sympathie entsteht. Außerdem fühlten die Bauenden sich durch die Selbstmontage kompetent, wobei das Produkt zum Beleg für ihre Fähigkeiten wird.

Investition in die Bindung
Wer vom Ikea-Effekt weiß, kann ihn nutzen, um sein Produkt aufzuwerten. Erfolgsmodelle außerhalb der blau-gelben Möbelwelt gibt es zur Genüge. Schon Kinder übersehen gern, dass ihnen mit jedem Überraschungsei billiges und oft nicht allzu amüsantes Plastikspielzeug untergejubelt wird, wenn sie es nur selbst zusammengesetzt haben. Sie malen Bilder nach Zahlen und blenden in Begeisterung über das Ergebnis eine rationale ästhetische Bewertung aus. Oder es werden Modellflugzeuge gebaut, in die so viel Arbeitsleistung investiert wurde, dass Flug und potenzieller Absturz als ein zu großes Betriebsrisiko eingestuft werden. Erwachsene pflücken ihre Beeren auf Feldern selbst und sind dann bereit, mehr zu bezahlen als im Supermarkt. Sie stricken Pullover aus Wolle, die unverarbeitet mehr kostet als ein industriell hergestelltes Kleidungsstück im Modehaus. Oder sie starten engagierte Heimwerker*innen-Projekte, über deren wacklig-schiefes Ergebnis geflissentlich hinweggesehen wird. Und wahrscheinlich ist auch der nachhaltige Erfolg von Lego auf nichts anderes zurückzuführen als den Ikea-Effekt – warum sonst würde man Flugzeuge und Bagger aus Klemmbausteinen im eigenen Regal so ausstellen, als wären sie ein archäologisches Exponat.

Lieb mich, reparier mich
Wird der Weg zum fertigen Produkt mit begleitet, wird auch ein besonderer Zugang und Bezug zu den Alltagsgegenständen entwickelt. Jede gelungene Montage ist ein kleines Erfolgserlebnis. Dabei ist es irrelevant, ob es sich um demokratische Günstig-Möbel handelt oder teure Produkte – auch das legt die Studie nahe. Wer seinem Designersofa einen neuen, vom Hersteller handgefertigten Bezug überzieht, wird in der Folge gegebenenfalls zur nachdrücklichen Rotwein-Polizei. Viele Unternehmen, die auf Direktvertrieb und heimischen Zusammenbau setzen – wie USM mit seinen etablierten Systemmöbeln, die Sofa-Pioniere von Noah Living oder Tylko-Regale – profitieren indirekt vom Ikea-Effekt. Gerade wenn sie ihre Produkte im Internet absetzen, auf Zwischenhändler verzichten und ihre Möbel mit Paketdienstleistern versenden, müssen sie nicht mit einer geringeren Akzeptanz rechnen, sondern vielmehr damit, dass ihre Kund*innen ihre Konstruktionsleistung stolz kommunizieren. Außerdem könnte der Ikea-Effekt sich auf ein weiteres, aktuell durch die neuen EU-Richtlinien viel diskutiertes Nachhaltigkeitsthema positiv auswirken: die Reparaturfähigkeit. Wer eine schwächelnde Kaffeemaschine mit wenigen Bauteilen aus dem Ebay-Kosmos wieder betriebsfähig schrauben kann, wird ihre erhaltene Funktionsfähigkeit umso mehr schätzen.
Mehr Stories
Wo Raum und Mensch sich berühren
Was die Ergonomie von Türbeschlägen ausmacht

Schluss mit Schluss mit lustig?
Die Rückkehr des Humorvollen auf der Dutch Design Week

Zweite Chance für den Boden
Nachhaltige Beläge zwischen Materialinnovation, Rückbau und Wiederverwendung

Farbe als Werkzeug
Burr Studio und Keßler Plescher Architekten über ein strategisches Entwurfsinstrument

Revisiting the Classics
Unsere Eindrücke von der Maison & Objet und der Déco Off in Paris

Wenn Möbel wachsen lernen
Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Countdown zur DOMOTEX
Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär
Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte
Urbane Gärten und Wälder für alle

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen
Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

„Alles auf Anfang“
100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

GREENTERIOR
Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin
Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln
Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Harmonische Kompositionen
Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Der Funke springt über
Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen
Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären
Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept
Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen
Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Von der Bank zum Baukasten
COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Eine Bühne für junge Talente
Maison & Objet feiert 30 Jahre und setzt auf Nachwuchs

Flexibilität in der Gestaltung
Beispielhafte Projekte setzen auf Systembaukästen von Gira

MINIMAL MASTERS
Wie die Shaker mit klaren Werten und asketischem Stil das Design prägen

Schatz in der Fassade
Warum der Austausch historischer Kastendoppelfenster ein Fehler ist

Von rau bis hedonistisch
Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen
DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept
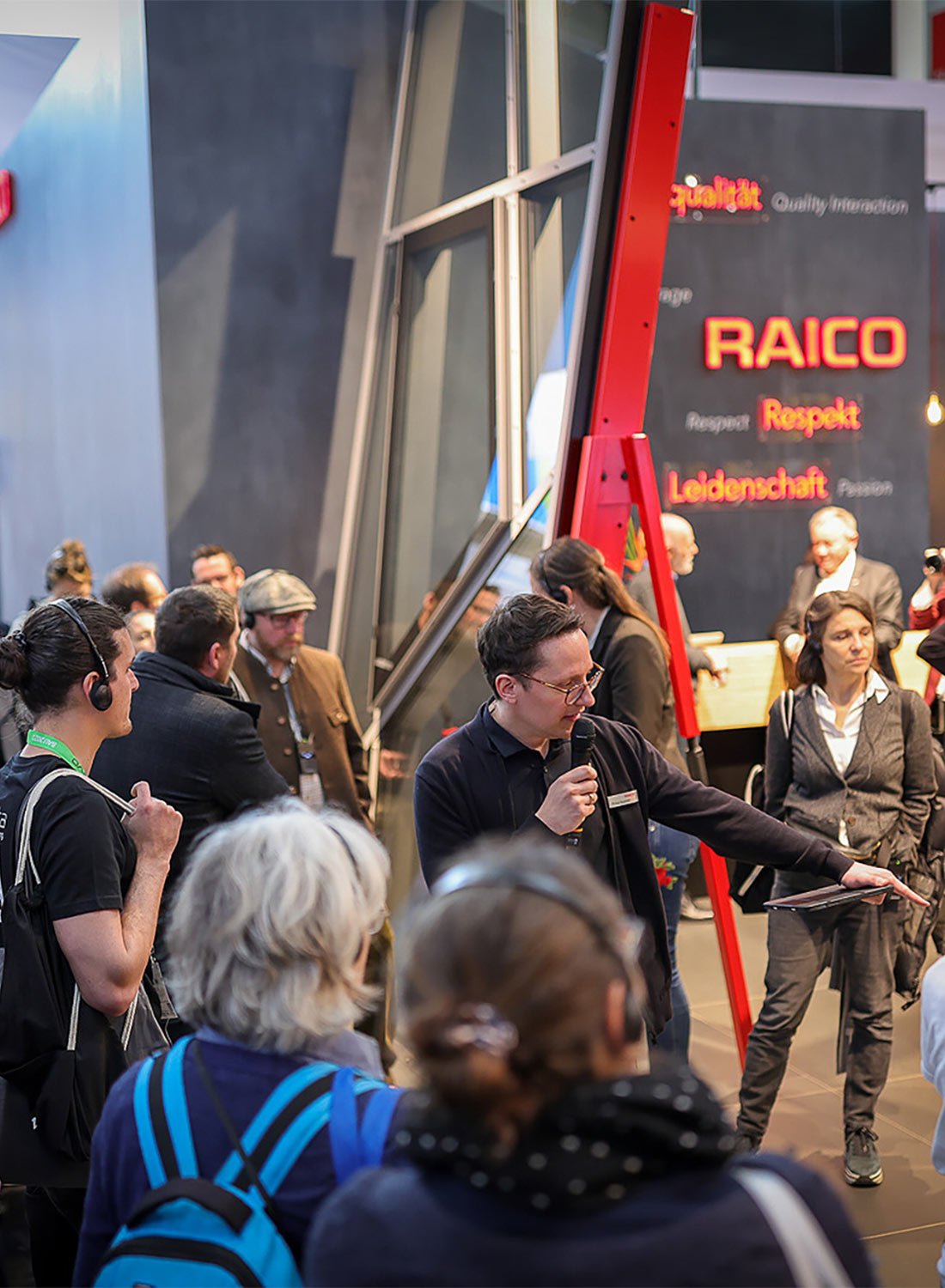
Der Stuhl, der CO₂ speichert
Mit einer Sitzschale aus Papier setzt Arper neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur
Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik
Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG
