Daniel Libeskind
1 / 9


Haus des Reisens, Berlin, Alexanderplatz. Aus DDR-Zeiten mit eben diesem Namen gesegnet, bleibt das Gebäude in Beton gegossener Zynismus. Heute ist hier ein Club untergebracht, Verlage haben ihre Heimstatt gefunden und im Made Space im neunten Stock traf unser Gastautor Andreas Tölke zum Abschluss der Architekturbiennale 2012 Daniel Libeskind. Ein Gespräch über Common Ground, Architektur als Kunst, Kapitalismus, seine Liebe zu Berlin und die Zukunft der Stadt.
Was David Chipperfield mit der gerade zu Ende gegangenen Biennale postulierte als „Ende der biografischen Architektur“, ist nichts Anderes als der Abgesang auf „Star-Architektur“. Sie sind ein Star. Was bedeutet diese Kritik für sie?
Ich war nie ein großer Verfechter der Anonymisierung von Architektur. Ich habe keine Lust auf Neutralisierung von ästhetischen Ausdrucksformen. Ich glaube an Architektur als Kunst. Ich glaube, dass Architektur schon per se Aufmerksamkeit generiert. Es geht nicht nur um einen so genannten Common Ground, einem Raum für alle. Wer sind diese alle? Eine Allgemeinheit ist die Summe einer dynamischen Gesellschaft. Es kommt also darauf an, wie man Common Ground definiert. Und wie man den Raum für Allgemeinheit liest. Es wird niemals eine Vereinbarung auf einen sozialen, gemeinsamen Boden geben, auf dem sich alle gleich bewegen. Es wird immer unterschiedliche Gewohnheiten, Funktionalitäten und besonders Ästhetiken geben. Das ist für mich Common Ground. Das Individuum, das dadurch geprägt wird. Etwas zu schaffen, was außerhalb des bis dato Vorstellbaren liegt – das ist die Aufgabe, der sich Architektur stellen muss. Es geht nicht nur darum, Problemlöser zu spielen, sondern Teil einer reichen großen Kultur zu sein.
Sie haben Kunst und Architektur in einem Atemzug genannt. Gibt es eine Trennlinie zwischen den Disziplinen? Ist es in Ihrer Wahrnehmung wirklich eine eigene Disziplin?
Ich glaube daran, dass Architektur eine gesellschaftliche Kunst ist. Keine private Kunst, die man alleine kreiert, sich an die Wand hängt oder in den Vorgarten stellt. Architektur wird auch nicht in der Privatheit eines Ateliers geschaffen und dann ausgestellt, wenn das Werk fertig ist. Der Schaffensprozess ist ein halb öffentlicher. Je nachdem, was entstehen soll. Es gibt Meetings mit vielen Beteiligten. Viele Menschen, die um einen Tisch sitzen und intensiv darüber sprechen, was ihre Vorstellungen sind und in wieweit sie erfüllt werden sollen. Architektur ist der Grundstock zum Gespräch. Aber sie wird zur Kunst, wenn sie weiter geht, als nur die Basisausrüstung für Bedürfnisse zu liefern.
Heißt das Avantgarde um jeden Preis? Völlig egal, wie die Nutzer mit einem Gebäude klar kommen?
Gute Architektur ist eine Maschinerie zur Befriedigung individueller und gesellschaftlicher Bedürfnisse. Ich bin demgegenüber, was die Biennale kommunizieren wollte, sehr aufgeschlossen. Die Fragestellung bewegt mich, seit ich arbeite. Aber ich habe diese Frage eben auch schon vorher gehört, sie wurde mir mehrfach gestellt. Und sie bewegt sich durch die Geschichte der Architektur. Trotzdem kann das Ergebnis einer solchen Diskussion, die immer wieder geführt werde muss, nicht sein, alles nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner auszurichten. Ich will keine neutrale Welt, in der jeder Hände schüttelnd und lächelnd Maschinendemokratie bestellt. Demokratie besteht aus Unterschieden. Und überlebt auch nur durch die Unterschiedlichkeit. Minderheiten, Randgruppen, die verschiedenen sozialen Schichten – ihre Meinungen prägen Demokratie und damit auch Architektur.
Ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was sie als Kunst-Architektur postulieren?
Architektur ist nicht die ästhetische Kommunikation eines Konsens. Ich war immer und bleibe auch für die Minderheitenarchitektur. Dinge, die auf einem weißen Papier entstehen und Visionen in sich tragen.
Die Visionen von heute, die Ikonen in der Architektur, vom Guggenheim Bilbao bis zur Ihrem Jüdischen Museum, sind in der Regel nur durch potente Geldgeber zu realisieren. Selbst, wenn sie Minderheiten angehören, zur Oberschicht gehören sie allemal. Kann unter der Ägide von Banken, Firmen und Institutionen wirklich visionär gestaltet werden?
Nein. Ich glaube nicht daran, dass die beste Architektur als Wiedergabe von Kapitalismus entsteht. Auf dem Land ist gute Architektur die Wiedergabe von Geschichte, eine Wiedergabe von Leben, von Träumen. Kapitalismuskritik ist einfach, aber man braucht Geld, um ein Gebäude zu schaffen. Wir wollen Architektur schaffen, die subjektiv auf die Kultur reagiert, die Verantwortung übernimmt für eine Kultur, die öffentlich ist. Es gibt eine öffentliche Stimme in der Architektur. Aber wir begingen doch Selbstmord, lehnten wir ernsthaft jede Form von monetärer Unterstützung ab. Wir werden die Wallstreet doch nicht darüber abschaffen, dass wir keine Gebäude mehr für potente Geldgeber bauen. Warum geht es nicht um die Frage, darüber nachzudenken, welche alternativen Formen von Architektur auch ohne großes Kapital entstehen können?
Wenn wir uns Ihr Portfolio anschauen, ist der Einfluss von Bauherren etwa bei Ground Zero nicht von der Hand zu weisen – wie steht es um die eigene Eitelkeit, wenn der Geldgeber die Vision immer weiter runter kocht?
Das ist ein kreativer Prozess. Meine Gebäude werden nicht von Bauherren geschaffen. Aber ich arbeite sehr eng mit Bauherren zusammen. Gerade bei einem sehr großen Projekt geht es darum, eine bestimmte Logistik nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt Parameter, nach denen ich mich richten muss. Ein bestimmter Anzahl an nutzbaren Quadratmetern, ein Kontingent an bestimmten Flächen für bestimmte Nutzungen et cetera et cetera. Dazu kommt, dass die Forderungen nach zeitgemäßer Architektur auch Forderungen nach einer zeitgemäßen Technologie mit sich bringt. Diese neuen Technologien kann ich nicht bis ins Detail beherrschen. Wir holen dafür die entsprechenden Experten mit ins Boot. Aber das ist ein ganz normaler Arbeitsprozess, das war schon in der Agora bei den Griechen so, 500 vor Christus und im dritten Jahrhundert in China. Experten waren immer dazu da, um Architekten dabei zu unterstützen, ein sinnvolles Gebäude zu schaffen. Gemeinsam sind Visionen dann realisierbar.
Architektur hat mit sozialer Kompetenz zu tun....
... und ich als Architekt habe eine soziale Profession. Dazu gehört auch zu fordern. Nämlich die Bewohner einer Stadt als Experten zu integrieren. Alle müssen mit einem Gebäude leben können. Aber am Ende ist es doch der Architekt, der dafür verantwortlich ist, was entsteht. Es gibt genug Architekten, die die Gier von Banken entsprechend bedienen. Die die Gier eines reichen Kunden in Form ausdrücken. Das war für das ich nie interessant. Natürlich habe ich große Kunden, aber meine Architektur war nie darauf ausgerichtet, deren Werte zu vermitteln. Ich will die Werte einer offenen, demokratischen Gesellschaft kommunizieren.
Noch mal zur Eitelkeit – Architektur bleibt, oft für Jahrhunderte. Ist ein Architekt getrieben von Allmachtsphantasien?
Ich sage das mit großem, großem Ernst: Man muss an Demokratie glauben. Aber muss auch den Glauben an das eigene Potenzial haben. Ich bin doch nicht der Einzige auf diesem Planeten. Gerade bei Ground Zero gibt es so viele beteiligte Parteien. Angefangen bei den Familien der Opfer, zu denen ich während der Zeit ein sehr enges und intensives Verhältnis aufgebaut habe. Dann gibt den Gouverneur von New York, den Gouverneur von New Jersey. Es gibt die Besitzer des Areals, den Bürgermeister, die Betreiber der U-Bahn. Das Wichtigste war für mich nicht die Darstellung einer wie auch immer gearteten ästhetischen Macht der Türme. Die war natürlich extrem wichtig, aber sie war nicht das, woran ich am intensivsten dachte, während ich die Entwürfe machte. Wie können wir einen öffentlichen Raum gestalten, der auf der einen Seite ein Mahnmal ist, aber auf der anderen Seite eine Aussicht? Natürlich gibt es dabei Kompromisse, das ist unbestritten.
Viele Köche verderben.... Der Sinnspruch ist bekannt. Wie sieht das in der Planung und Realisation aus? Bis zu welchem Punkt sind sie involviert?
Natürlich bin ich nicht der Schöpfer von jedem Winkel und jedem Fensterrahmen. Wie gesagt, bei so vielen Parametern wäre das völlig absurd, für jeden Wasserhahn verantwortlich zu zeichnen. Das Museum, das Besucherzentrum, all diese Dinge eingebunden in einen öffentlichen Raum, der mich deutlich mehr fasziniert als alles andere. All diese Orte sind intensiver und spannender als die Türme, und vor allem: der Ausdruck einer demokratischen Kultur. Nach all den Kämpfen finde ich sehr das Ensemble sehr optimistisch. Das ist genau das, was ich erreichen will.
Ihre erste weltweit wahrgenommen Arbeit war das Jüdischen Museum in Berlin. Aktuell wird die Blumenhalle vis à vis als Dependance eröffnet. Sie sind oft in Berlin. Wie sehen sie die Stadt?
Ich bin ein Berliner, mein Sohn ist Berliner, meine Enkel sind Berliner und leben hier. Ich liebe Berlin und ich glaube, dass Berlin eine große Zukunft hat.
Aber was ist mit den verpassten Chancen im Bereich Architektur?
Mich interessieren Plätze nicht, die versuchen, virtuelle Realitäten zu produzieren. Eine sehr begrenzte Vision von einer Stadt und Architektur ... Aber ich glaube, das ist vorbei. Diese Ära verschwindet. Der Wind dreht sich, die Ergebnisse sind noch nicht sichtbar, aber die Zukunft von Berlin sind nicht die 30 m hohen Türme oder die langweilige Rekonstruktion von Historismus. Die Öffentlichkeit verlangt nach mehr öffentlichen Plätzen und Räumen. Es wird eine Veränderung in der Sozial-Struktur geben. Die Verdrängung, die passiert, wird logischerweise weiter voranschreiten, und es liegt an den Bürgern selbst, sich dagegen entsprechend zu wehren, ihre Rechte einzufordern, damit keine monothematischen Ghettos entstehen. Berlin wird auch in der Architektur neugierig bleiben.
Oft wird von ausländischen Beobachtern die Geschichtsverdrängung kritisiert. Die Symbole der DDR verschwinden aus dem Stadtbild, die historischen Plätze des Naziterrors sind unzureichend markiert – es fehlt zum Beispiel jeglicher Hinweis auf den Führerbunker.
Das stimmt leider. Aber es ist auch verständlich, dass Berlin als Zentrum zweiter Diktaturen den Weg in eine Normalität sucht. Die Stadt kann auch kein Freilichtmuseum für deutsche Geschichte sein. In wieweit eine Verdrängung mit dem Abriss der Monumente einhergeht, wage ich nicht einzuschätzen. Meine Erfahrung, wie sich Deutsche mit ihrer Historie auseinandersetzen, ist eine ausgesprochen positive. Der öffentliche Diskurs ist erstaunlich offen und intensiv.
Die Frage aller Fragen zum Schluss: Ihre Vision für eine Stadt von morgen?
Aufgrund der Veränderung von Datenströmen wird es möglich sein, dass der Individualverkehr ohne Stau beständig gleitet. Das heißt, Bürgersteige werden breiter, Straßen werden schmaler, Ampelanlagen anachronistisch. Der öffentliche Nahverkehr muss den individuellen Bedürfnissen mehr entsprechend, als es zur Zeit vorstellbar ist. Mehr Raum zum Leben, weniger Raum für Bewegung. Und am Beispiel Berlin ist zu erkennen, dass auf Dauer eine viel, viel höhere Dichte erreicht werden muss. Diese Dichte muss Lebensraum für jeden Einzelnen sein. Das wird Konsequenzen haben für soziale Räume und wie eine Stadt aussieht: kompakt und divers.
Links
Daniel Libeskind
daniel-libeskind.comMehr Menschen
Alchemist des Alltags
Wie der Designer Harry Nuriev Vertrautes neu inszeniert

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“
Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Deutsch-Amerikanische Freundschaft
Studiobesuch bei Ester Bruzkus und Peter Greenberg in Berlin

Das Leichte und das Schwere
Die außergewöhnlichen Bauwerke des Architekten Christian Tonko

Tapeten, die bleiben
Felicitas Erfurt-Gordon über nachhaltige und wohngesunde Produkte von Erfurt & Sohn
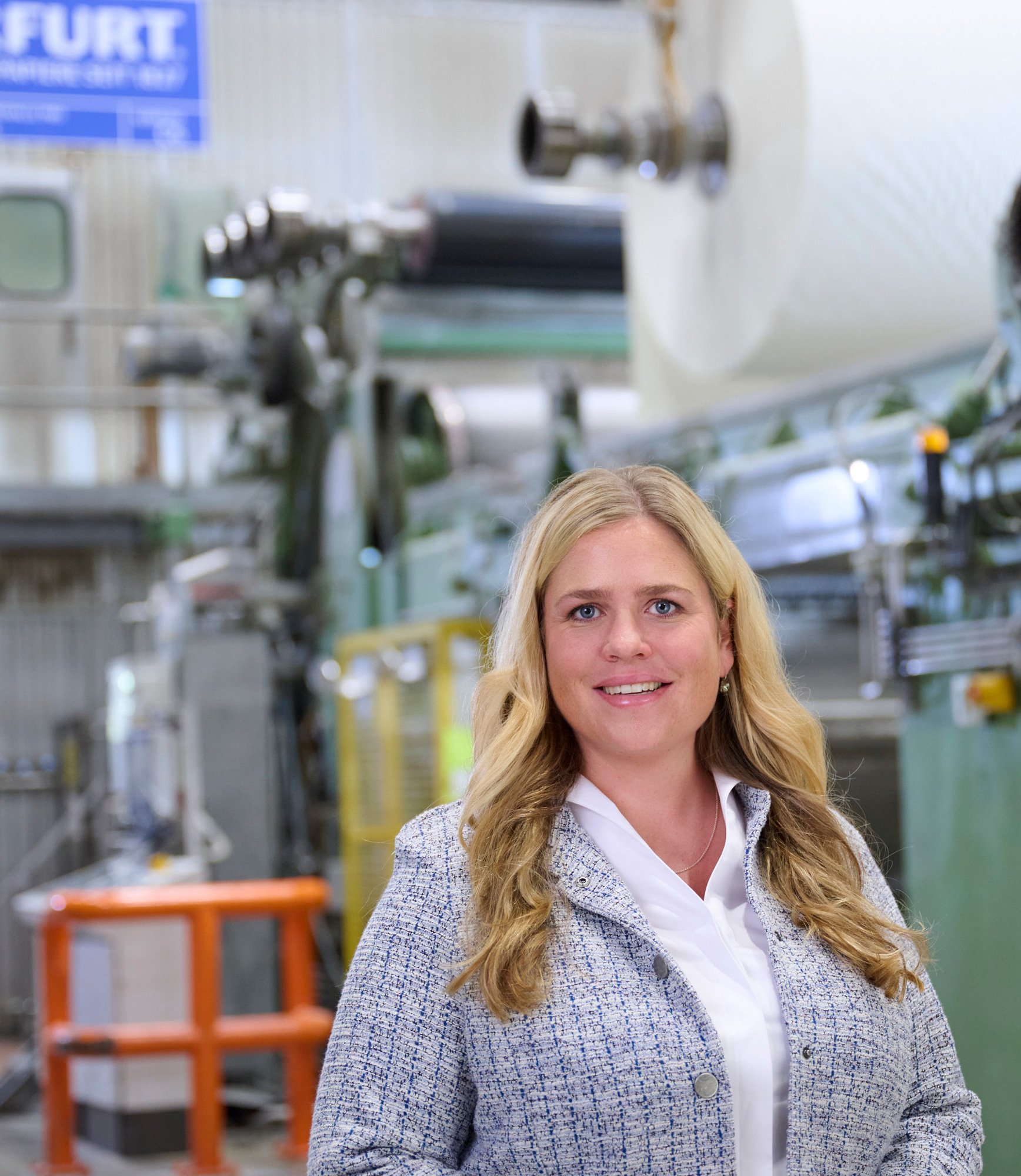
New Kids on the Block
Junge Gestalter*innen erobern die Designwelt

Wut in Kreativität verwandelt
Interview mit der ukrainischen Gestalterin Victoria Yakusha

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“
Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Gemeinsam weiterkommen
Designkollektive auf der Vienna Design Week 2025

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“
Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Experimentierfreude und Nachhaltigkeit
Interview mit dem italienischen Gestalter Harry Thaler

Gespür für innere Logik
Interview mit dem niederländischen Designduo Julia Dozsa und Jan van Dalfsen

Ganzheitliche Gestaltung
Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

Handmade in Marseille
Studiobesuch bei Sarah Espeute von Œuvres Sensibles

Welt aus Kork
Der New Yorker Architekt David Rockwell über das neue Potenzial eines alten Materials

Voller Fantasie
Studiobesuch bei Joana Astolfi in Lissabon

Auf ein Neues!
Fünf Architektur- und Designbüros stellen ihren Re-Use-Ansatz vor

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren
Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

„Die Hände haben eine eigene Intelligenz“
Das Berliner Designduo Meyers & Fügmann im Gespräch

Marrakesch, mon amour
Laurence Leenaert von LRNCE interpretiert das marokkanische Handwerk neu

Konzeptionelle Narrative
Studiobesuch bei Lineatur in Berlin

New Kids on the Block
Junge Interior- und Designstudios – Teil 3

„Einfach machen, nicht nachdenken“
Der Designer Frederik Fialin im Gespräch

„Schweizer Design ist knäckebrotmäßig auf die Essenz reduziert!"
Christian Brändle vom Museum für Gestaltung Zürich im Gespräch

Entwürfe für die Neue Wirklichkeit
Ein Interview mit dem Museumsgründer Rafael Horzon

„Wir wollen einen Kokon schaffen“
studioutte aus Mailand im Interview

Berliner Avantgarde
Studiobesuch bei Vaust in Berlin-Schöneberg

Designstar des Nahen Ostens
Hausbesuch bei der libanesischen Gestalterin Nada Debs in Dubai

Cologne Connections
Junge Designer*innen sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 2

Design als Klebstoff
Junge Gestaltende sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 1
