Neue Münchner Freiheit mit Kollektiv A
Ein Interview über die Freiheit

Für einen Prominenten entwerfen sie gerade ein Gebäude für dessen Kunstsammlung. In Berlin haben sie ein 20.000-Euro-Haus gebaut, und in den Bergen soll bald das Zuhause für einen Schriftsteller entstehen. Das A steht für Architektur, im Kollektiv erhalten sich die fünf jungen Architekten ihre Freiheit. Geplant wird, wie sie das Leben verstehen: mit Optimismus.
Begonnen haben sie zu dritt, heute sind sie zu fünft: Die Architekten Benedict Esche, Lionel Esche, Lena Kwasow-Esche, Jonas Altmann und Nils Rostek sind zusammen ein starkes Team. Eine Besonderheit bei ihrem Kollektiv A ist, dass es ohne festes Büro auskommt. Manchmal werden projektweise auch andere junge Architekten hinzugeholt. Klingt nach einem Experiment. Wir treffen die fünf am Ort des Geschehens, auf der Baustelle im ersten Obergeschoss eines Cafés, das sie gerade grundsanieren und umbauen. Sein Name könnte kaum passender sein: Münchner Freiheit.
Ihr seid noch jung, voller Ideen und genießt eine gewisse Freiheit: Wenn man auf der einen Seite Architektur als Gesamtkunstwerk betrachtet und auf der anderen Seite Architektur als Dienstleistung, wo würdet ihr euch einordnen?
Benedict Esche: Ich glaube, dass es schon immer um ein Gesamtbild geht. Was sich aber nicht negiert: Denn wir sind auch Dienstleister. Die Aufgabe stellt uns jemand. In dem Sinne sind wir Rahmenbauer. Und der Rahmen kann total kunstvoll sein. Der ist dann das Gesamtkunstwerk, aber zugeschnitten auf die Aufgabe.
Lena Kwasow-Esche: Es sind zwei Dinge, die ineinandergreifen. Erst durch die Aufgabe, die wir gestellt bekommen, und indem wir den Kontext analysieren, können wir kunstvoll arbeiten. Was wiederum auch nur eine Plattform für die Bauherren selbst ist. Sie bringen meistens eine starke Geschichte mit, einen Charakter, oder eine Philosophie. Wir versuchen, das widerzuspiegeln.
Vereint euch fünf der Gedanke, Architektur mehr als Dienstleistung zu sehen?
Benedict Esche: Oho!
Nils Rostek: (unterbricht) Ich glaube, dass Architektur dann stark ist, wenn sie diese Ganzheitlichkeit als Gesamtkunstwerk gewährleisten kann. Wenn man eine gute Idee hat, ist das Formale ein Endprodukt davon, was aber in verschiedenen Nuancen anders sein kann. Die Idee muss lesbar bleiben. Das kann man auch einem Bauherrn verkaufen. Und wenn er da so weit mitgeht, dann kann man als Architekt auch auf Ansprüche und Änderungen des Bauherrn eingehen. Wichtig ist, dass man eine Idee, ein starkes Konzept hat. Dann fängt Architektur an, Spaß zu machen.
Seit 2015 arbeitet ihr kontinuierlich zusammen, habt aber kein gemeinsames Büro, wohnt nicht mal alle in München. Wie funktioniert das praktisch? Wie geht ihr beispielweise mit Materialien um?
Benedict Esche: Es ist alles digital.
Was bedeutet, dass eure Art zu arbeiten auch erst seit Kurzem überhaupt möglich ist. Ohne Internet hätte sich ein Kollektiv junger Architekten vermutlich nicht so einfach organisieren können …
Benedict Esche: Wenn, dann auf jeden Fall viel langsamer.
Und wo arbeitet ihr?
Lena Kwasow-Esche: Im Flugzeug, im Zug und in der Hotellobby …
Jonas Altmann: Im Homeoffice, im Café, auf dem Amt.
Benedict Esche: Im Nachtbus von München nach Graz ...
Lionel Esche: Zuhause und auch auf den Baustellen.
Nils Rostek: Ja, oft sind wir direkt vor Ort, auf der Baustelle. Das ist super. Eigentlich sollte man immer so arbeiten, weil man alles sofort überprüfen kann.
Wie tauscht ihr Informationen aus?
Benedict Esche: Grundsätzlich kann man das Material, Heft oder Buch von Arbeitsplatz A nach B mitnehmen. Und man kennt es auch aus größeren Büros: Am Ende weiß man dort manchmal auch nicht mehr, wer welches Magazin wo abgelegt oder mitgenommen hat. Und wenn wir an klassische Bürowelten denken: Dort kann man oft beobachten, dass die Mitarbeiter aus verschiedenen Etagen auch nicht mehr direkt miteinander reden. Vielleicht treffen sie sich irgendwann einmal in der Kaffeeküche, aber sie könnten theo-retisch genauso gut 10.000 Kilometer voneinander entfernt arbeiten, weil sie am Ende doch nur per Mail miteinander kommunizieren. Wir arbeiten nicht anders, nur vielleicht etwas gemütlicher: auf der Couch, im Bett und mal am Küchentisch.
Und wie geht ihr in den Entwurfsprozess? Erarbeitet ihr das Konzept alle fünf zusammen?
Lionel Esche: Das ist ganz unterschiedlich und auch abhängig davon, wer gerade Zeit hat. Wenn wir an einem Wettbewerb teilnehmen, sprechen wir uns untereinander ab. Dann entwickelt sich eine Diskussion, in die sich jeder der fünf Köpfe einbringt, auch einer, der den Wettbewerb vielleicht gar nicht so gut kennt. So wird seine Meinung zu einer Kritik, die die anderen wieder voranstößt und weiterbringt.
Und was macht ihr mit euren Modellen?
Benedict Esche: Die werden wieder auseinandergebaut.
Lionel Esche: … die schönen Präsentationsmodelle lagern bei uns zuhause.
Lena Kwasow-Esche: Je nachdem, wie die Projekte verteilt waren, archivieren sich auch die Modelle in den jeweiligen Kellern … Der Mensch konserviert gerne. Aber ich glaube, uns hilft das Loslassen von den Dingen auch ein Stück, uns weniger in vergangenen Projekten zu bewegen. Unser Fokus richtet sich nach vorne.
Welche Rolle spielt eure Webseite?
Benedict Esche: Eine Webseite funktioniert wie eine Briefmarkensammlung. Sie ist einfach, chronologisch geordnet und ohne Hierarchie.
Hierarchie ist ein gutes Stichwort: Gibt es bei euch pro Projekt einen Tonangeber? Oder seid ihr ohne Leitung organisiert?
Jonas Altmann: Jeder von uns übernimmt eine Projektleitung.
Benedict Esche: Was bedeutet, dass derjenige das letzte Wort hat, aber auch, dass wir alle Frage diskutieren.
Jonas Altmann: Es geht bei dieser Rolle letztendlich darum, den Betriebsablauf zu steuern. Sonst läuft es nicht. Und der Bauherr wünscht sich meist nur einen Ansprechpartner.
Und wie entscheidet ihr, wer welches Projekt adoptiert und begleitet?
Benedict Esche: Das ergibt sich eigentlich aus dem jeweiligen Zeitplan und Ablauf, und daraus, wieviel Leidenschaft jemand gerade in ein Projekt geben kann. Zum Beispiel ist es bei den Wettbewerben so, dass wir diese zeitlich gar nicht mehr so intensiv betreuen können, aber Lionel bringt hier wahnsinnig viel Zeit und Energie ein. Oder das Projekt in der Musenbergstraße, für das Jonas wie ein Löwe um das Baurecht gekämpft hat. Aber jedem von den anderen bleibt trotzdem die Möglichkeit hineinzupiksen und etwas infrage zu stellen. Wir glauben, dass nur durch Diskussionen ein gutes Ergebnis entstehen kann.
Bei welchen Themen seid ihr denn verschiedener Ansicht? Worum drehen sich eure Diskussionen?
Benedict Esche und Nils Rostek: (zeitgleich und vehement): Baukosten.
Alle lachen. Pause.
Nils Rostek: Anspruch und Baukosten. Ideal und Realität – daran reibt man sich immer.
Lena Kwasow-Esche: Manchmal muss einer wieder auf den Boden geholt werden, weil er sich in den Wolken bewegt und mehr will, als die Kapazitäten hergeben können. Also muss er von den anderen geerdet werden. Aber wir wollen natürlich alle gerne immer mehr, als möglich ist.
Benedict Esche: Was auch spannend werden kann, mit einem winzigen Budget einen Traum zu erfüllen. Wie zum Beispiel bei dem 20.000-Euro-Haus in Berlin. Als wir auf Schrottplätze gefahren sind und Material gesammelt haben … das war schön.
Jonas Altmann: (lacht) Das war eher schwierig.
Benedict sagt, es war schön – Jonas sagt, es war schwierig.
Jonas Altmann: Da sieht man unsere Rollenverteilung.
Benedict Esche: Sagen wir, es war schwierig-schön!
Ihr habt uns erzählt, dass ihr kein Manifest, sondern eine Grundlagenregelung für euch als Partner habt. Was verbindet euch?
Benedict Esche: Regeln und Ausnahmen.
Jonas Altmann: Wir sind Architekten, die gerne einfach bauen. Fürs Stadtmarketing funktioniert ein Bau von Zaha Hadid – was aber irgendwie nur eine Show-Architektur bleibt, weil sich unter der gemorphten Fassade oft auch nicht mehr als eine rechteckige Halle verbirgt. Ich denke, das ist ein Zeichen unserer Arbeit: Diese vereinfachte Ästhetik. Klarheit. Das verbindet uns.
Lionel Esche: Es ist eine Klarheit, aber dann kommt dazu immer eine Ausnahme, so eine Art Störung, die in den Projekten verhaftet ist.
Wie die Biberstütze, von der ihr erzählt habt?
Benedict Esche: Genau. Eine spezifische Radikalität, das mögen wir gerne. Wie die Pendelstütze, die nur vertikale Lasten abträgt, aber für das Projekt trotzdem einen Sinn ergibt.
Würdet ihr euch als Idealisten bezeichnen?
Nils Rostek: Schon.
Jonas Altmann: Noch …
Benedict Esche: Ich würde sagen, wir sind Idealisten mit einem Realitätsanspruch. Am Ende muss eine Idee auch umsetzbar sein. Wir können nicht die Welt verändern, aber in einem kleinen Rahmen können wir Zukunft gestalten und auch etwas ändern. Wir können Orte positiv aufladen und damit der Stadt einen kleinen Schubs geben. Durch jede unserer Architekturen zieht sich immer ein Thema durch, eine gewisse Geschichte. Und erst wenn diese Geschichte klar ist, eine Leitidee verfolgt, das kann auch ein abstraktes Wort sein, dann können wir ein Projekt entwickeln.
Wie viele Projekte laufen denn bei euch gerade parallel?
Benedict Esche: Der Neubau an der Kolbergstraße für Stefan Höglmaier, dann Potsdam, das Haus Seidenstücker in Berlin, das Café Münchener Freiheit, das Café Staatsbibliothek, das Café am Marienplatz. Abgeschlossen sind der Dachgarten am Stachus, die Dachgeschossaufstockung und ein Ausbau. Wettbewerbe und ein Ferienhaus in Tübingen. Zudem arbeiten wir gerade an Studien für Gaming- Hotels in Lissabon, Barcelona und Rom.
Empfindet ihr eure Arbeit als politisch?
Benedict Esche: Architektur ist immer politisch.
Nils Rostek: Wenn ich ein Wohnhaus baue, bedeutet das keinen gesellschaftlichen Diskurs. Wenn ich etwas im öffentlichen Raum mache oder Diskurse anzettel, ist es auf jeden Fall politisch.
Benedict Esche: Projekte wie das 20.000-Euro-Haus sind auch politisch: weil sie das Wohnen am Existenzminimum aufzeigen, und auch, dass dieser Traum mit wenig Budget möglich ist.
Jonas Altmann: Na ja. Er ist möglich, weil wir als Architekten damit kaum Geld verdienen.
Benedict Esche: Klar, das kann man sich ja ausrechnen: 20.000 Euro nach HOAI sind natürlich absurd. Aber aus diesem Grund haben wir das Projekt nicht angenommen. Jetzt ist es fertig. Auch das Haus für den Physiotherapeuten hatte ein winziges Budget. Weil wir finden, dass es auch eine Wichtigkeit hat. Und um zu zeigen, dass man auch mit ganz wenig hochqualitativ bauen kann.
Für euch fing das Kollektiv mit einer Krise an: Ihr habt 2015 Unterkünfte für Flüchtlinge entworfen, die zunächst auch gebaut werden sollten. Formt euch das?
Jonas Altmann: Das ist ja die Aufgabe, die man auch gerne als Architekt hätte: eine gesellschaftliche Aufgabe. Wobei das Thema schon vorher existierte: Der Mangel an Wohnraum in München war ja schon immer bekannt. Für uns war das ein Projekt, mit dem man in den Fokus treten kann – es handelt sich ja nicht um eine energetische Sanierung. Mit den Flüchtlingsunterkünften konnten wir uns eine Büroideologie aufbauen.
Womit sich auch eine Vision herauskristallisiert, für die ihr steht. Spürt ihr denn, dass eure Generation vielleicht vor anderen Herausforderungen steht als die vorigen? Stehen wir vor einem Umbruch?
Nils Rostek: Ich denke, das ist wahnsinnig komplex. Noch mal zurück zu dem kleinen Häuschen: Bei solchen Projekten muss man auch sehen, dass sie aus städtebaulicher Sicht kompletter Wahnsinn sind. Eigentlich müsste man doch größere Strukturen planen und verdichten. Natürlich versuchen wir, aus einer Aufgabe das Beste zu machen, aber der Komplexität sind wir uns durchaus bewusst. Es gibt einfach klare Grenzen, denen wir als Architekten ausgesetzt sind. Wir können weder die Gesellschaft noch die Gesetzgebung ändern. Da wird es relevant: Wir können das Beste für einen kleinen Teil machen, und da verausgaben wir uns und handeln als Idealisten. Aber gesellschaftliche Veränderungen, die mehr als einen singulären Entwurf bedeuten, sind auf anderen Ebenen zu verhandeln.
Benedict Esche: Auf der Metaebene sind wir als Architekten limitiert. Wir können Diskurse beginnen.
Ist das der Grundgedanke, der letztlich auch zu eurer Galerie in München geführt hat?
Benedict Esche: Da ging es uns vor allem darum, zu zeigen was Architektur alles kann. München ist schon eher ein Ort mit einer konservativen, etablierten Elite, die die Diskurse bestimmt und auch die relevanten Aufgaben baut. Es ist jedenfalls nicht die Stadt, in die ich als junger Architekt gehen würde, weil sie mich unterstützt. Man muss kämpfen. Und mit der Galerie wollten wir einen Exkurs und die Vernetzung in der Stadt fördern.
Nils Rostek: Es war eine Art Vakuum.
Benedict Esche: In München entwickelt sich langsam eine Szene von jungen Architekturbüros, die spannend sind. Mit denen man gerne am Abend bei einem Bier darüber diskutieren würde, wie man die Probleme dieser Stadt lösen könnte. Es fehlt ein Sprachrohr und ein Ort, an dem man sich trifft.
Ihr habt in diesen Ort sogar jede Menge Geld investiert.
Nils Rostek: Richtig. Aus einer sehr großen idealistischen Motivation heraus: Weil wir denken, dass mehr von den Architekten, die wir in die Galerie eingeladen haben, zum Beispiel in München bauen sollten. Unseres Erachtens würde München dadurch viel spannender werden.
Stellt ihr denn fest, dass sich andere junge Architekten in einer vergleichbaren Gedankenwelt bewegen?
Benedict Esche: Was wir sehen ist, dass es ein durchgehendes Kritikastertum gibt. Das haben wir auch versucht, mit der Galerie aufzubrechen. Dass wir aus derselben Generation damit aufhören, andere Büros zu „haten“. Es gibt genug Platz und Raum für alle. Der Obelisk, den wir in der Villa Massimo entwickelt haben, zeigt genau das. Es gibt noch so wahnsinnig viel Raum für uns alle.
Die Zeit der großen Architekten geht auch langsam vorüber …
Jonas Altmann: Die Berliner Techno-Szene hat das doch schon vorgemacht: Man will keinen Artist mehr, keinen Popstar auf der Bühne. Wer braucht noch einen Stararchitekten mit 300 Mitarbeitern, wenn jeder weiß, dass auch in den großen Büros die jungen Talente den Entwurf planen?
Wie würdet ihr das Wettbewerbssystem verändern, wenn ihr etwas ändern könntet?
Benedict Esche: Ich wünsche mir die offenen Wettbewerbe der Fünfziger- und Sechzigerjahre zurück, aus denen die großen Dreibuchstabenbüros stammen. Jeder kennt die Geschichte von gmp und dem Flughafen Tegel. Heute traut man so etwas jungen Architekten gar nicht mehr zu.
Sie bekommen selten überhaupt eine Chance, es zu versuchen.
Benedict Esche: Junge Architekten dürfen nicht mal an den Wettbewerben teilnehmen. Wenn man das verändern könnte, dann sollten die Verfahren auf jeden Fall zweiphasig sein. So könnten es sich auch kleinere und jüngere Büros überhaupt leisten, teilzunehmen. Das wäre ein System, das funktioniert.
Nils Rostek: Es gibt ja noch das französische Prinzip: Man bewirbt sich, und nur vier Büros nehmen teil, werden aber auch dafür bezahlt. Dann muss man nicht gewinnen, um zu überleben – man könnte also fast sagen, jedes europäische Land bietet bessere Voraussetzungen für Architektenwettbewerbe als Deutschland.
Habt ihr eine Vision oder eine Hoffnung für die Architektur – national wie international?
Benedict Esche: Mehr Mut und auch wieder mehr Offenheit. Und mehr Zusammenarbeit zwischen den Büros wie mit Studio Spatio oder Atelier Fala.
Jonas Altmann: Das sehe ich ähnlich. Aber ich finde auch, dass die HOAI reformiert werden muss. Unser Job ist falsch bezahlt.
Lena Kwasow-Esche: Für mich ist der Punkt wichtig, der die Ausführung angeht, und auch die Produkte, die auf dem Markt sind. Da wird uns sehr vieles diktiert, was man als Architekt zu verwenden hat. Auch wenn die ENEV versucht zu regeln, dass heute ökologisch gebaut wird, entsprechen dem oft die Produkte gar nicht. Es wird enorm viel Kunststoff verbaut. Die Freiheit fehlt. Und auch, dass man kleinere Gewerke und Manufakturen fördert und so auch wieder Kreativität von innovativen neuen Studios, wie TFOB, die ihr vorgestellt habt. Müsste man viel stärker fördern!
Und woher schöpft ihr euren Optimismus?
Lena Kwasow-Esche: Eigentlich aus den Gesprächen mit anderen jungen Architekten, aber auch Menschen aus unserer Umgebung: Nachbarn, Bauherren, Flüchtlingen.
Also das Gegenteil zum klassischen Architekt mit seinem weißen Kittel im Atelier. Wie versteht ihr euren Beruf?
Benedict Esche: Es ist weit mehr als ein Beruf!
Aber es bleibt auch ein Job, mit dem ihr Geld verdient, eure Miete bezahlt.
Benedict Esche: Jetzt hast du etwas angestoßen.
Lena Kwasow-Esche: Es verschwimmt mit Hobbys.
Nils Rostek: Hobbys?
Jonas Altmann lacht laut auf.
Lionel Esche: Architektur ist etwas, das mir auch Kraft zurückgibt. Ich vergnüge mich daran, freue mich über neue Ideen und Gedanken.
Benedict Esche: Architektur ist auch so wahnsinnig sinnstiftend.
Lena Kwasow-Esche: Aber auch Künstler aus anderen Disziplinen inspirieren uns.
Was ist für euch wichtiger als die Architektur?
Nils Rostek: Freunde und Familie sind uns allen wichtiger als die Architektur. Es gibt dieses Zitat von Valerio Olgiati, dass er für Architektur sterben würde – das finde ich übertrieben. Da hast du ja nichts mehr davon. (Pause) Aber ich bin schon besessen. Architektur ist wichtig. Und super.
Lionel Esche: Familie.
Jonas Altmann: Das sind dann auch Architekten…
Nils Rostek: Ich habe mein Studium mit einer unglaublichen Naivität angefangen. Meine Vorstellung von Architektur hatte nichts damit zu tun. Und dann ist es noch mal genauso: Wenn man nach dem Studium in die Realität kommt, ist es auch etwas anders. Deshalb glaube ich, die Frage stellt sich eher nach dem Dabeibleiben. Warum bleibt man bei der Architektur?
Jonas Altmann: Ich glaube, weil man etwas selbst meistert. Man kreiert und steuert etwas, das einem eigentlich über den Kopf wächst – was man aber zum Schluss dennoch meistert. Das ist für mich das Faszinierende.
Lena Kwasow-Esche: Bei mir ist es die Freude am Machen. Das Anfassen und die Recherche von Materialien. Es ist wie kochen, man schaut nach verschiedenen Kräutern, sucht nach neuen Rezepten. Es ist diese Suche – nicht nur das Resultat. Das verliert etwas an Bedeutung. Der Prozess des Machens bedeutet schon genug Freude.
Wenn gerade überall die Zukunft der Bullshitjobs diskutiert wird. Wozu zählt für euch Architektur?
Benedict Esche: Architektur ist sinnstiftend. Es gibt so viele Berufe, bei denen man sinnlos seine Stunden absitzt. Da sehe ich die Architekten doch in einer ganz guten Position – auch wenn man damit heute nur selten reich wird.
Nils Rostek: Ich finde es total faszinierend, denn einen Musiker würde man niemals fragen, warum er Musik macht.
Ist das Kollektiv die Antwort?
Benedict Esche: Für mich ist das Kollektiv eine Idealstruktur, um sich weiterzuentwickeln.
Jonas Altmann: Sehe ich auch so! Ich kann allein entwerfen, aber dann brauche ich ein Gegenüber. Ich brauche auch den Kritiker. Ohne den geht es nicht.
Lionel Esche: Unsere kleinen Differenzen sind wahnsinnig gut und wichtig, weil dadurch erst die Reibung und die Diskussion entstehen, aus denen sich wiederum etwas entwickeln kann.
Wie geht ihr mit Niederlagen um?
Lena Kwasow-Esche: Nach vorne schauen!
Findet ihr euch mutig?
Benedict Esche: Für einen Krankenhausbau wäre ich nicht mutig genug. Das müssten wir diskutieren, ob wir das machen.
Jonas Altmann: Ja!
Nils Rostek: Da geht schon noch was!
FOTOGRAFIE Cyrill Matter
Cyrill Matter
Mehr Menschen
„Gerade die Struktur ermöglicht Freiheit“
Warum das modulare Prinzip von USM bis heute relevant ist

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“
Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Schönheit neu definieren
Wie ein Stuhl Kreislaufdenken, Ästhetik und Klimaschutz zusammenführt

Altholz mit Zukunft
Hanna-Maria Greve von WINI über die Idee der wiederverwendbaren Spanplatte

„Zirkularität ist kein gestalterischer Kompromiss“
Concular Spaces über die Chancen kreislauffähiger Büroinnenausbauten

Liebe zu exzellenter Gestaltung
Burkhard Remmers über das nachhaltige Design des neuen WiChair

Wir sollten die Möglichkeiten unserer Zeit besser nutzen
Ein Gespräch mit dem Arbeitswissenschaftler Dr. Stefan Rief

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“
Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Lokal global
Vince Berbegal über die mediterrane DNA und globale Vision von Actiu
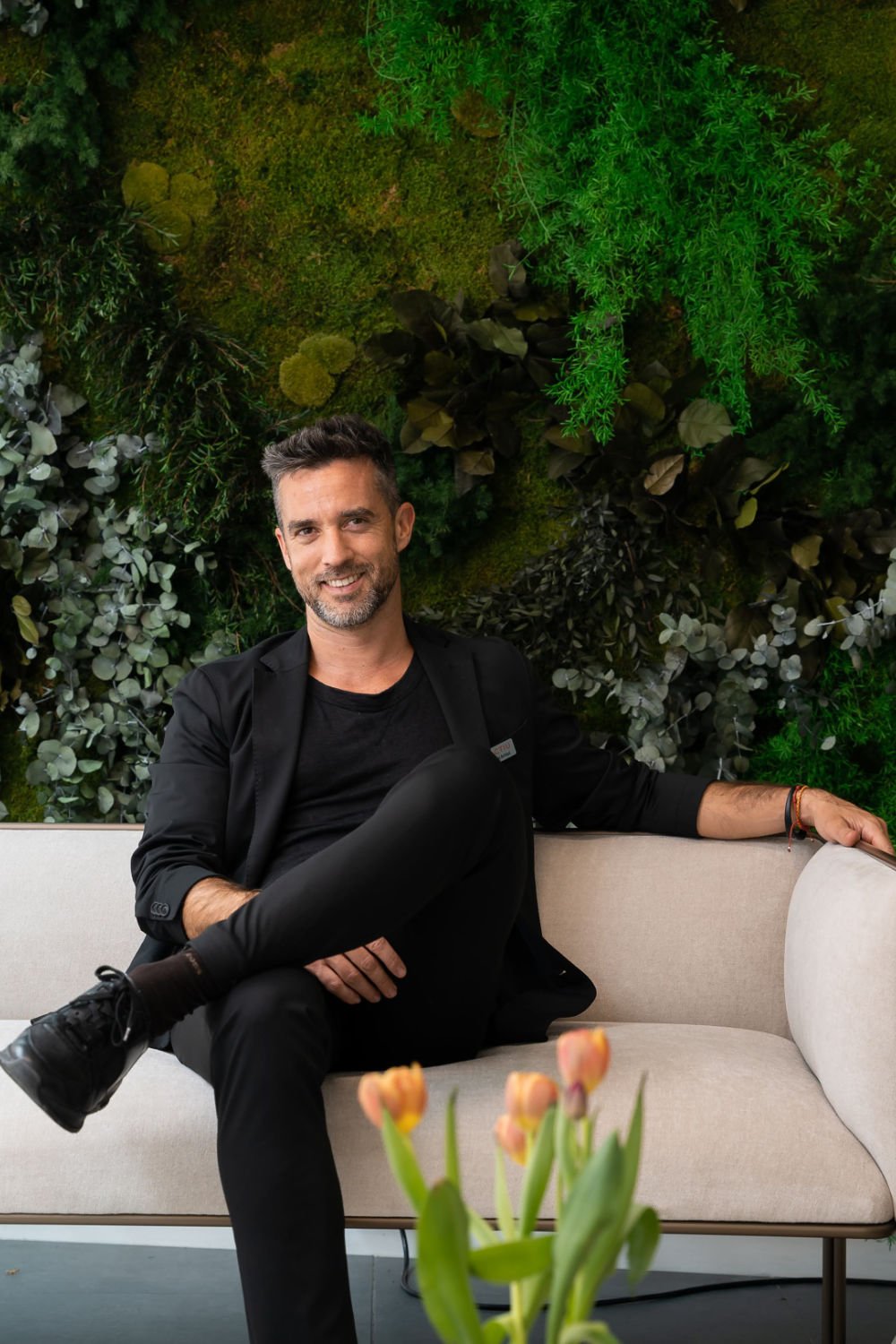
„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“
Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Einfach Ruhe
Ein Gespräch mit dem Berlin Acoustics-Gründer Manuel Diekmann

Ganzheitliche Gestaltung
Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren
Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

Design als Problemlöser
Interview mit Jonas Pettersson von Form Us With Love

Zukunftsperspektiven für zeitlose Möbel
Ein Gespräch mit Rolf Keller über die Kreislaufwirtschaft bei Vitra

Das Büro als Bühne
Wilkhahn launcht Magazin über agiles Arbeiten

Treffpunkt Workcafé
Ernst Holzapfel von Sedus im Gespräch

Design als Klebstoff
Junge Gestaltende sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 1

Der Büroplatz zum Wohlfühlen
Dirk Hindenberg von Klöber im Interview

„Wir müssen Möglichkeitsräume schaffen“
Der Architekt Klaus de Winder im Gespräch

Design-Statements auf der Wand
Ein Interview mit Julian Waning von Gira

Alles ist verbunden
Ausblick auf die Orgatec 2024 mit Dr. Jens Gebhardt von Kinnarps

„Qualität und Nachhaltigkeit gehören zusammen“
Ein Gespräch mit Johanna Ljunggren von Kinnarps

Form follows availability
Sven Urselmann über kreislauffähige Einrichtungskonzepte

Möbel, die das Leben bereichern
René Martens über den holistischen Designanspruch von Noah Living

Hochprozentig nachhaltig
Mathias Seiler über die Kollektion Incycle von Girsberger

Das Gute trifft das Schöne
Interview über die Kooperation von Arper und PaperShell

Ein Designer in olympischer Höchstform
Mathieu Lehanneur im Gespräch

New Kids on the Block
Interior- und Designstudios aus Berlin – Teil 2

„Man muss vor der KI nicht zu viel Respekt haben“
Technologie-Insider Timm Wilks im Interview
