Designer ohne Grenzen
Ein Interview mit Sebastian Herkner, der sich treu bleibt

Sebastian Herkner kommt gerade aus Mailand zurück, fast zeitgleich erreichen erste Prototypen von Ames, Dedon und Thonet sein Offenbacher Studio, da klingeln zwei Journalisten aus Berlin. Während sich der Designer empört, dass Siemens zum Jahresende trotz Milliardengewinn knapp 7.000 Mitarbeiter entlassen wird und wir uns über die Krise des Wohnungsmarkts austauschen, die inzwischen auch Offenbach erreicht hat, fragen wir uns, wie sich die Welt verändern wird.
Sebastian hat in Offenbach studiert und ist dort geblieben. Das Bild, das auch durch den Beitrag zur Architekturbiennale 2016 in Venedig von seiner Stadt gezeichnet wurde, ärgert ihn. Sein Studio befindet sich in der Geleitstraße, die an einem Ende von herrschaftlichen Villen gesäumt ist und am anderen eher an Berlin-Kreuzberg erinnert. Das Studio Herkner sitzt genau in der Mitte. In der Mitte angekommen sind, wie Sebastian betont, auch viele der angeblich nur Durchreisenden in seiner Arrival-City. Herkner selbst ist viel unterwegs. Allerdings weniger, um in aller Welt an glamourösen Veranstaltungen teilzunehmen, als vielmehr um auf seinen Reisen eine Nähe zu Kulturen und Kulturtechniken zu finden.
Ob Glas, Messing, Keramik oder Holz: Du arbeitest immer wieder eng mit Handwerkern zusammen. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Design und Gestaltung – Handwerker gestalten schließlich auch. Wo fängt Design an, wo kommst du ins Spiel? Ein Designer beobachtet viel interdisziplinärer und geht weiter als ein Handwerker, der in der Regel in seinem Metier und seiner Materialität bleibt. Ein Designer interpretiert hingegen ein Material oder eine Aufgabe und stellt sich durch Veränderungen zum Beispiel gesellschaftlicher Natur oder neue Kombinationen neuen Herausforderungen. Es ist eher ein Designer als ein Handwerker, der sich neue Ideen überlegt.
Zum Beispiel? Unsere Zusammenarbeit mit der Firma Kaufmann Keramik, die seit 50 Jahren Kacheln für Kachelöfen in Bayern produziert. Im Gespräch kam ich darauf, dass man mal Tische aus der Kachelkeramik machen könnte, das Material also auf ein anderes Möbel zu übertragen. Mir ist es wichtig, das Potenzial des Handwerks, einer Technik und des Know-hows herauszufinden und für einen komplett anderen Bereich zu nutzen.
Es geht also darum, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Ein Handwerker ist auf eine gewisse Technik spezialisiert. Die Frage, ob man diese auch mal anders nutzen kann, stellt sich der Spezialist eher selten. Man muss den Handwerkern mit Respekt begegnen – egal ob sie in Kolumbien oder hier in Deutschland sitzen – damit sie dazu bereit sind, über Veränderungen nachzudenken. Und das Gegenüber muss beweglich sein – sonst kommt die Antwort: „Wir haben das schon immer so gemacht.“
Welche Rolle spielen neue Technologien in deinem Studio? Wir entwerfen sehr viel digital, aber die Hightech-Anmutung steht bei uns nicht im Vordergrund, sondern die Qualität, die aus dem Handwerk kommt. Unser neuer Stuhl für Thonet verbindet zum Beispiel beides. Es gibt die klassischen Bugholzelemente, die unter heißem Wasserdampf gebogen werden, es gibt aber auch Elemente, die CNC-gefräst werden. Im Zentrum steht der Wunsch, für jedes Element den besten Herstellungsprozess zu finden.
Im Vorgespräch haben wir über das Moment des Antitrends geredet. Du magst es gerne, dich gegen einen Trend zu stellen und gibst damit eine neue Richtung vor. In deinem Portfolio hingegen fehlt der rote Faden. Wie passiert das? Zufall? Ich glaube, das ist eine Haltung, die sich von alleine entwickelt hat. Das Paradebeispiel dafür ist der Bell Table, bei dem ich die Materialien auf den Kopf gestellt habe. Und das Material selbst war etwas aus der Zeit: Messing galt 2009 als altmodisch, wie bei Oma. Als ich studiert habe, arbeitete man eher mit Kunststoff. Ich fand es trotzdem spannend, Messing und Glas neu zu kombinieren. Mal wirklich gegen den Strom schwimmen, das ist viel aufregender.
War die Idee beim Bell Table, bewusst gegen den Strom zu schwimmen, oder die Haltung, sich zu hinterfragen? Ich hinterfrage mich ja ständig. Das Gegenüber bleibt an einem Produkt, das erst einmal ungewöhnlich ist, eher hängen und muss sich damit auseinandersetzen. Das ist ja bei der Kunst genauso, dass man dann stehen bleibt. Man muss sich daran reiben. So entstehen Energien und Interesse.
Wie überzeugst du die Hersteller, die eher eine sichere Nummer wollen? Auf den Messen ähneln sich ja viele Neuheiten. Ich brauche natürlich mutige Unternehmen wie Moroso oder Pulpo und muss den Hersteller mit einem Konzept überzeugen, ihn abholen. Das geht nur, wenn man das gemeinsam angeht und beide Seiten es verstehen. Design ist ja keine One-Man-Show. Da müssen alle an einem Strang ziehen: vom Polsterer bis zum Marketing.
Wie gehst du mit Kritik um? Finde ich prinzipiell immer gut – solange sie objektiv bleibt. Es gibt ja auch Leute, die den Bell Table nicht gut finden. Oder den Moroso-Sessel Pipe: Das dicke Gestell kam in einer Zeit, in der alles immer filigraner wurde. Der eine findet es fettwurstig, der andere meint, es sieht brutalistisch aus. So entsteht eine ganz andere Auseinandersetzung, als wenn man einfach nur ein schönes Möbel macht.
Manche Stimmen bezeichnen deine Arbeiten als gefällig. Ist das für dich eine Kritik? Nö.
Wie ist denn deine Haltung zum Funktionalismus? Gibt es für dich die wahre, gute Form? Das ist schwierig. Wenn man einen Stuhl entwirft, gibt es so viele Parameter. Wie hoch muss die Rückenlehne sein? Wie sitzt man wirklich, denn in der Realität sitzt man nie gerade, sondern immer etwas gelümmelt. Dann gibt es Leute, die sind nur 1,50 Meter groß, andere aber zwei Meter. Da wird es schwierig, den optimalen Stuhl zu entwerfen, auf dem wirklich jeder bequem sitzt.
Was ist wichtiger: die Ästhetik, das Konzept? Für mich ist das eine Mischung aus allem.
Andere Designer stellen das konzeptionelle Arbeiten in den Vordergrund, und am Ende soll sich ein Produkt auch gut anfühlen und schick aussehen. Genau, aber erst am Ende! Farbe und Material spielen bei uns von Beginn an eine entscheidende Rolle. Bei vielen Gestaltern kommt die Farbe erst zum Schluss, und letztendlich entscheidet man sich für die fünf üblichen Corbusier-Farben. Dabei funktioniert nicht jede Farbe mit jedem Möbel und jedem Material.
Manche haben auch Angst vor Farbe. Wir entwickeln immer aus der Farbe heraus. Deswegen haben wir auch die vielen Glasfarbordner, um damit zu spielen. Bei Textilien ist es genauso, die lassen sich ohne ihre jeweilige Farbe nicht gestalten. Und entscheidend ist hier natürlich auch das Verhältnis von Licht und Schatten. Eine Farbe verändert sich im Tagesverlauf erheblich und ist stets vom Material abhängig.
Apropos Textilien: Du hast während des Studiums bei Stella McCartney gearbeitet, was deinen Arbeitsansatz sicher auch beeinflusst hat. Klar. In meinem Praktikum habe ich gelernt, wie man Farbe denkt und mit Materialcollagen arbeitet. Das war neben dem Studium ein wichtiger Grundstein. (macht eine Pause) Ich denke gerade noch über das „gefällig“ nach. „Gefällig“ kommt ja vermutlich von „gefallen“. Ich glaube, es kauft sich niemand ein Möbel, das ihm nicht gefällt. Bei der Kunst ist das sicher anders.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Viele kaufen sicherlich Status: uniforme Einrichtungen und Markennamen, mit denen man nichts falsch machen kann. Wenn man sich aber nur mit Klassikern einrichtet, kann auch nichts Neues entstehen. Eben! Und natürlich will ich als Designer, dass die Produkte Gefallen finden, denn ich habe ja ein Interesse daran, dass sie in eher großer Stückzahl verkauft werden.
Als ein junger Mann im baden-württembergischen Bad Mergentheim sein Abitur macht, weiß er sehr genau, was er werden will: Sebastian Herkner will die Dinge gestalten, die uns umgeben – er will Möbel entwerfen, Leuchten, Accessoires. Mit der Allgemeinen Hochschulreife und dem Großen Latinum in der Tasche, das eher für Jura oder Medizin prädestiniert als für ein Designstudium, fährt er 130 Kilometer zur Mappenberatung an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Das ist 17 Jahre her.
Du bist relativ jung erfolgreich geworden. Wenige deutsche Designer in deinem Alter arbeiten für so viele internationale Hersteller und haben rund 100 Produkte auf dem Markt. Deine Erklärung? Es kommt auch immer darauf an, woran man arbeitet. Manche Designer wollen eher neue Materialien und Technologien austesten, das benötigt oftmals mehrere Jahre. Wir haben hier einen ganz anderen Ansatz und deshalb vielleicht auch einen anderen Output. Viele meiner Projekte sind ja keine hochentwicklungsbedürftigen Produkte, da sie auf bestehendem Handwerk aufbauen. Dabei ist Handwerk auch nicht immer ein schnellerer Prozess. Die Zusammenarbeit mit Dedon an Mbrace hat circa drei Jahre gedauert, und wir entwickeln aktuell die Kollektion noch weiter. Anknüpfungspunkt mit Dedon war mein Interesse am Handwerk und am Material. Wir haben bei Mbrace zum ersten Mal Teak mit dem typischen Geflecht verbunden und so auch ein sehr erfolgreiches Produkt geschaffen. (überlegt) Aber wenn ich mir die aktuellen Produkte der Kollegen ansehe, kommt da plötzlich sehr viel Handwerk vor. Ich mache das kontinuierlich schon seit zehn Jahren.
Was auch viel mit dem Wunsch der Kunden nach Individualisierung zu tun hat. Da warst du früh dabei. Es sind leider auch heute eher wenige Designer, die sich wirklich mit lokalem Handwerk in designuntypischen Ländern auseinandersetzen. Matali Crasset macht solche Projekte und Stephen Burks, das war’s auch schon. Für mich ist es eine wahnsinnige Bereicherung – aber auch für die anderen Firmen, mit denen ich arbeite. Ich lerne ja genauso bei einem Flechtprojekt in Kolumbien wie bei meinen Produkten für Moroso oder Cappellini. Und so profitieren alle voneinander, weil ich von allen etwas mitnehme.
Dennoch bleibt die enge Kooperation mit Handwerkern aus aller Welt etwas Ungewöhnliches. Mir hat in meiner Arbeit eine gewisse soziale Komponente gefehlt. Designer arbeiten ja viel im Premiumbereich, fahren nach Mailand, feiern tolle Partys: Alles in allem ist das sehr elitär. Wenn ein Arzt in seinem Job etwas vermisst, kann er bei Ärzte ohne Grenzen mitarbeiten. Deshalb gefällt mir der Gedanke des „Designers ohne Grenzen“. Aber es sollte eben kein One-Shot sein, was leider nicht immer funktioniert. In Simbabwe haben sich zum Beispiel nicht die passenden Strukturen ergeben, weil ein Mittelsmann gefehlt hat. Aber bei Ames in Kolumbien klappt es. Und es wächst. Für einige der Beteiligten vor Ort hat sich die Ames-Kollektion wirklich positiv ausgewirkt. Ebenso auch bei der Glasmanufaktur von Poschinger, die ich 2009 im Vorfeld des SaloneSatellite recherchiert habe. Dort wurden die ersten Bell Tables geblasen und seit 2012 werden sie für ClassiCon dort auch in Serie produziert. Poschinger hat vorher meist nur Einzelstücke hergestellt, seit dem Bell Table hat die Manufaktur etwas, das regelmäßig läuft, konnte weiteres Personal einstellen, hat Auszubildende und so weiter.

Es geht dir also um Kreisläufe und Prozesse, die hinter einem Produkt stehen, und nicht unbedingt darum, dass es durch eine Verlagerung der Produktion möglichst günstig wird. Das hätte ich beim Bell Table nicht mitgemacht. Bei manchen Produkten geht es leider nicht anders, zum Beispiel bei Dedon: Das Flechtwerk ist so aufwendig, die Herstellung wäre in Deutschland viel zu teuer. Dedon macht das aber seit vielen Jahren in einem guten Rahmen, in einem Land, in dem das Handwerk an seinem Entstehungsort kulturell verankert ist. Viele Firmen könnten aber in ihrem eigenen Land, oder gar in ihrem eigenen Werk produzieren, gehen jedoch woanders hin, wo es wesentlich günstiger ist, und behalten den alten Preis! Das kann man vor allem bei einigen dänischen Firmen beobachten. Dabei kann man gerade in Deutschland verfolgen, was das für eine Region bedeutet und wie sie sich verändert, wenn Produktionsstandorte geschlossen werden. Wenn die Struktur zusammenbricht, bleibt es immer an den Schwachen hängen. Ich finde, so eine Verantwortung tragen Designer mit.
Was bedeutet für dich in diesem Zusammenhang der Begriff des „demokratischen“ Designs? Design sollte eigentlich das Ziel haben, für jeden erschwinglich zu sein. Die Krux an dieser Geschichte ist natürlich, dass viele Dinge, die handwerklich in hoher Qualität gefertigt werden, leider für viele eben nicht erschwinglich sind.
Aber man muss sich ja auch nicht jeden Tag einen neuen Stuhl, Schrank oder ein neues Sofa kaufen. Geht es dabei nicht eher um eine Haltung zum Konsum? Da muss die Gesellschaft noch einiges lernen. Eine Kampagne wie „Geiz ist geil“ hat dazu beigetragen, dass die Leute eben lieber viermal bei Aldi eine Gartenschere kaufen als einmal bei Gardena. Solche Fehler machen wir natürlich alle. Wenn man aber mal die Erfahrung macht, dass ein paar gute Schuhe viele Jahre halten, hinterlässt das Spuren. Mein Ziel ist eigentlich, so etwas wie Kompagnons zu schaffen. Produkte, die den Käufer über einen langen Zeitraum begleiten, die mit umziehen, vielleicht sogar weitervererbt werden.
Also geht es dir um Zeitlosigkeit? Ich weiß nicht. Wenn man „zeitlos“ sagt, denken die Leute immer, dass es schlicht, einfach und weiß sein muss. Muss es aber gar nicht. Auf der Messe stehen die Produkte immer in tollen Farben da, aber bestellt wird Beige, Grau und Braun, vielleicht noch Dunkelblau. Einfach weil man denkt: Das ist zeitlos.
Wie würdest du dann Zeitlosigkeit definieren? Ich denke, Zeitlosigkeit ist ein individuell belegter Begriff. Wichtig ist, dass man Dinge kauft, an denen man lange Freude hat. Für mich kann auch ein grünes Sofa zeitlos sein, wenn ich es wirklich lange habe. Es ist wahrscheinlich weniger eine Frage der Gestaltung, sondern mehr des Charakters und der Qualität. Wobei Qualität eben nicht bedeutet, dass etwas über einen langen Zeitraum unzerstörbar ist, sondern dass es durchaus Patina, also einen positiven Mangel, bekommen darf. Wie man es bei einer Ledertasche kennt. Die Frage lautet also vielmehr, wie ein Produkt altert. Deshalb ist der Messingring beim Bell Table aus massivem Messing. Wenn da ein Kratzer reinkommt, dann ist da ein Kratzer drin, aber es platzt nichts ab. Materialität und Verarbeitung sind wichtig.
Was können Architekten von Designern lernen? Müssen die was von uns lernen? Ein Designer arbeitet natürlich in einem ganz anderen Maßstab – mit dem Vorteil, dass er Prototypen machen kann. Viele der bekannten Architekten bauen Skulpturen, eher ausdrucksstarke, egozentrische Gebäude. Was ich persönlich nicht mag: Wenn ein Gebäude ein Kunstmuseum sein soll, aber der Kunst nicht dient – wenn Architektur selbst versucht, ein Kunstwerk zu sein. Gebäude sollen mehr als nur fotogen sein. Es gibt aber auch solche Gockel im Design, die ihr Ding machen …
… mit einem erkennbaren roten Faden. Bei uns ergeben sich die Vielfalt und Facetten der Produkte auch deshalb, weil wir mit komplett unterschiedlichen Hersteller zusammenarbeiten: Ein Moroso-Entwurf unterscheidet sich natürlich deutlich von einem Entwurf für Thonet. Ein Designer ist ein Dienstleister. Er muss ein perfektes Produkt liefern. Genauso wie ein Gärtner einen perfekten Garten machen muss.
Mit dem Studioumbau im März 2017 hat sich das Leben des Designers verändert. Es gibt jetzt eine private Wohnung und einen Ort zum Arbeiten. Es gibt aber immer noch keinen Feierabend und kein Wochenende. Denn der Designer bezeichnet sich selbst als Workaholic. Stillstand und Kontemplation sind nicht seine Sache. Seinen Erfolg führt er darauf zurück, dass er von Anfang an alles gegeben hat. Dazu gehört eben auch, zehn Jahre lang auf Urlaub zu verzichten, den Salone del Mobile als Jungdesigner aus dem Auto heraus zu besuchen oder darauf zu sparen, seine Entwürfe auf kleineren Messen und Veranstaltungen zu präsentieren. Alles für sein Design. Seine eigene Person betreffend ist Herkner hingegen vollkommen unprätentiös. Eine Ausstellung über sein Schaffen, ein Buch? Das alles erscheint ihm überflüssig.
Design ist für dich eine Dienstleistung? Natürlich, was soll es denn sonst sein?
Eine Form von Kunst, würden einige sicher antworten. Das klingt so, als dürfte Dienstleitung nicht kreativ sein. Ich werde ja beauftragt, also bin ich ein Dienstleister. Indem ich ein Briefing bekomme, gehe ich mit einer Firma eine Kooperation ein. Beim Künstler ist es etwas anderes: Er hat maximal eine Verpflichtung gegenüber seinem Galeristen zu erfüllen. Natürlich ist Produktgestaltung eine kreative Arbeit, aber auch eine Form von Dienstleistung. Ich mag es nicht, wenn Gestalter sich als Künstler wahrnehmen. Ich denke, das steht uns nicht zu. Kunst hat nicht wirklich etwas mit Design zu tun, und umgekehrt. Daher verstehe ich auch Kollegen nicht, die sich in Kunst versuchen.
Ohne den Hersteller würde man ein Produkt ja nicht auf die Messe und den Markt bringen. Genau. Das machen aber die anderen Designer auch. Außer, sie produzieren selbst, was ja gerade in meiner Generation sehr wächst und wovor ich Respekt habe. Ich wollte das aber nie, ich möchte ja nicht noch für den Vertrieb und den Versand zuständig sein, sondern möglichst kreativ bleiben.
Wie entsteht denn deiner Erfahrung nach ein erfolgreiches Produkt? Es sind viele Faktoren, die ein Produkt erfolgreich machen. Der Entwurf kann super sein, aber das Unternehmen hat gespart, Studenten beauftragt, und die Fotos sind miserabel. Oder die Location ist schlecht, die Mutti hat gestylt – hab ich alles schon erlebt. Fotos sind wahnsinnig entscheidend. Die Präsentation ist wichtig, auch die Agenten: Glauben sie an das Produkt, glauben sie an das Unternehmen? Glauben sie an eine Vision der Firma oder setzen sie nur auf Klassiker? Und wenn alles klappt, muss es natürlich beim Händler stehen und in einem guten Kontext perfekt arrangiert sein. Wenn der Händler das Produkt dann verkauft, einmal, ein zweites Mal, bestellt er nach und: Es funktioniert.

Welche Rolle spielt dabei heute die Ästhetik? Es gab jetzt viele Jahre, in denen alles sehr puristisch und skandinavisch war, von den Farben her sehr weich und pastellig. Aber ich glaube, das wird sich nun langsam ändern. Es wird wieder eleganter – nicht im Sinne einer Opulenz, sondern eher Pariser Chic. Auch die Farben werden gerade wieder kräftiger.
Worauf führst du das zurück? Das sind Beobachtungen. Oder vielleicht auch nur mein Wunsch? (lächelt)
Empfindest du dich eigentlich als Industriedesigner? (Denkpause) Ich sehe mich eher als Produktgestalter und finde diesen Begriff für mich auch passender. „Industrie“ klingt ja immer nach wahnsinnig großen Stückzahlen, die wir im Bereich Möbel fast alle nicht haben. Das müsste man also definieren. Natürlich werden einige meiner Produkte industriell hergestellt. Aber ich arbeite viel mit Manufakturen: Moroso, Capellini und Thonet sind ja alles handwerklich geprägte Hersteller.
Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit dem Handwerk? Mal geht es um etwas sehr Feines und Perfektionistisches. Mal ist es wirkliches Handwerk, im Sinne einer Individualität der Ergebnisse, wie bei den Vasen für Ames, die den Prozess der Entstehung gerade durch ihre Imperfektion verraten. Was eine besondere Ausstrahlung, Ästhetik und Schönheit haben kann. Das Wichtigste bei Produkten ist, authentisch und ehrlich zu bleiben.
Und kompromissbereit zu sein. Ich lasse mir sowohl von den Handwerkern als auch von den Herstellern etwas sagen und gehe Kompromisse ein. Design ist ein langer Prozess. Ein Dialog zwischen vielen Partnern und Experten. Ich maße mir nicht an, in jedem Bereich Experte zu sein. Ich benötige das jeweilige Feedback, um das Beste aus einer Idee zu bekommen. Selbstverständlich stehe ich zu 100 Prozent hinter jedem meiner Produkte. Sonst breche ich ab, kommt auch mal vor. Es ist wichtig, diesen Moment zu erkennen, „Falsch“ oder „Nein“ zu sagen.
„Falsch“ zu sagen? Man muss Ideen verwerfen, Geometrien anpassen, Kompromisse eingehen. Ich möchte kein Produkt durchprügeln, es müssen alle Beteiligten dahinterstehen. Design ist Kooperation. Design ist Kommunikation. Was vielleicht der entscheidende Unterschied zwischen Künstlern und Dienstleistern ist: dass ich als Designer bereit bin, Kompromisse einzugehen.
Bist du eigentlich ein gläubiger Mensch? Nur bei Abflug und Landung. (lacht laut und schüttelt den Kopf) Nein, ich glaube an etwas. Ich weiß nur nicht genau, ob es ein Gott ist oder eine Philosophie. Zu glauben halte ich generell schon für wichtig. Bauch oder Kopf? Man muss beides haben! Manchmal hat man einfach eine rosarote Brille auf. Dann ist es gut, seine Ideen in eine Schublade zu legen und zwei oder drei Wochen später oder nach einer Reise noch mal in Ruhe zu schauen, ob man immer noch verliebt ist. Man hat Beziehungen mit seinen Ideen!
Auf der Suche nach einer treffenden Erklärung für den Erfolg von Sebastian Herkner können wir keine Antwort finden, die ins mediale Raster der Sensationen passt. Keine Reibungspunkte, keine Allüren, keine markigen Worte. Wo andere vom eigenen Ego getrieben einen Platz in der Welt beanspruchen, macht Herkner einfach unverdrossen das, was ihm Spaß macht: Reisen, Erkunden, Gestalten und Instagrammen. Denn verfolgen kann man den Designer auf seinen Reisen um die Welt fast täglich im Internet.
#DESIGNEROHNEGRENZEN #SEBASTIANHERKNER #DESIGN #HANDWERK #INTERIOR #BELLTABLE #SALONEDELMOBILE #IMMCOLOGNE #INTERVIEW #DEARMAGAZIN #INSTABOY #LASTEXITOFFENBACH
Bildergalerie ansehen…
FOTOGRAFIE Cyrill Matter
Cyrill Matter
Studio Sebastian Herkner
www.sebastianherkner.comSebastian Herkner bei Instagram
@sebastianherknerProdukte von Herkner bei DEAR
www.dear-magazin.deDEAR Magazin
Dieser Beitrag ist auch in unserer Printausgabe erschienen. Mehr Infos:
www.dear-magazin.deMehr Menschen
„Gerade die Struktur ermöglicht Freiheit“
Warum das modulare Prinzip von USM bis heute relevant ist

Alchemist des Alltags
Wie der Designer Harry Nuriev Vertrautes neu inszeniert

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“
Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Deutsch-Amerikanische Freundschaft
Studiobesuch bei Ester Bruzkus und Peter Greenberg in Berlin

Das Leichte und das Schwere
Die außergewöhnlichen Bauwerke des Architekten Christian Tonko

Tapeten, die bleiben
Felicitas Erfurt-Gordon über nachhaltige und wohngesunde Produkte von Erfurt & Sohn
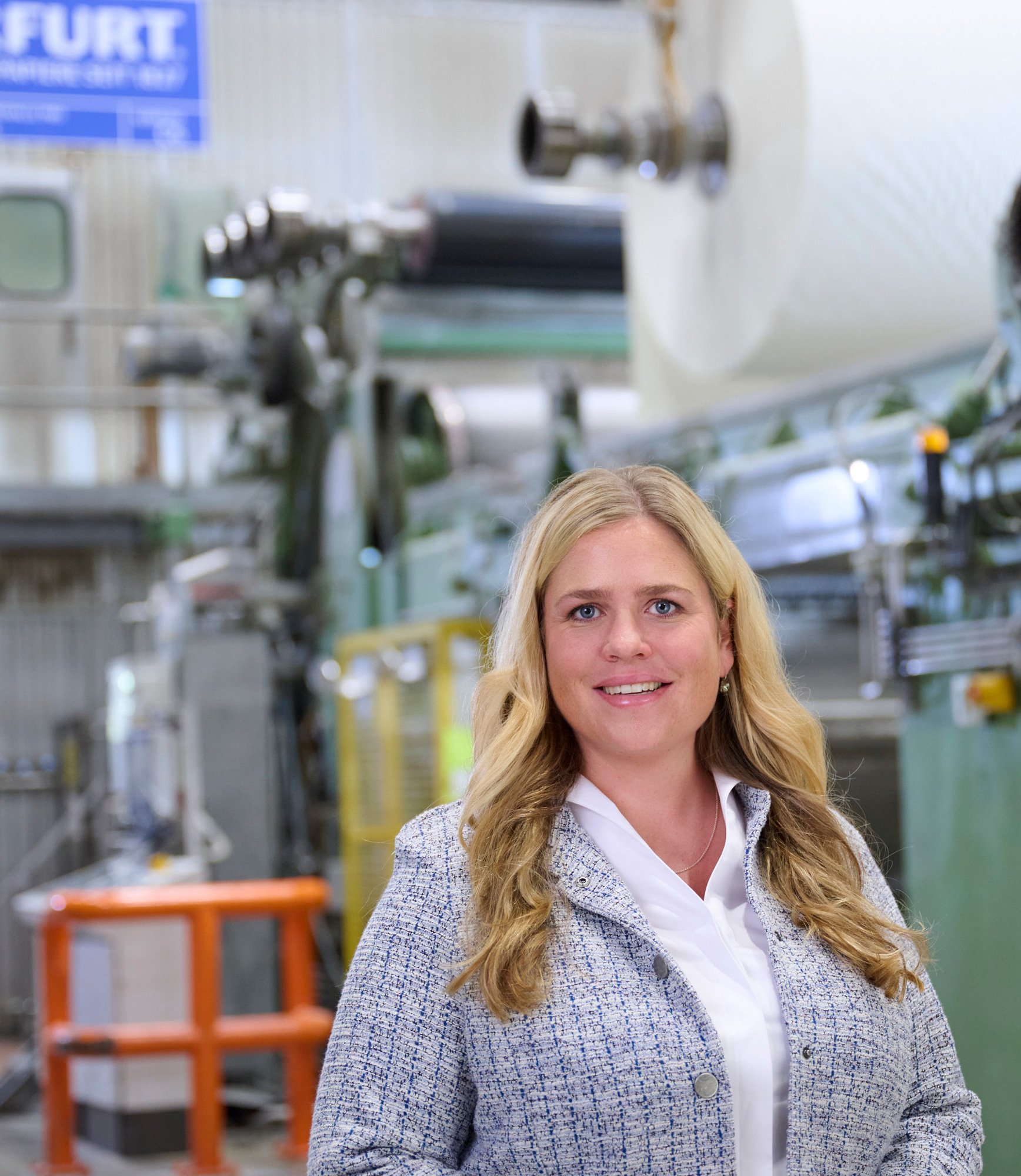
New Kids on the Block
Junge Gestalter*innen erobern die Designwelt

Wut in Kreativität verwandelt
Interview mit der ukrainischen Gestalterin Victoria Yakusha

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“
Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Gemeinsam weiterkommen
Designkollektive auf der Vienna Design Week 2025

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“
Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Experimentierfreude und Nachhaltigkeit
Interview mit dem italienischen Gestalter Harry Thaler

Gespür für innere Logik
Interview mit dem niederländischen Designduo Julia Dozsa und Jan van Dalfsen

Ganzheitliche Gestaltung
Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

Handmade in Marseille
Studiobesuch bei Sarah Espeute von Œuvres Sensibles

Welt aus Kork
Der New Yorker Architekt David Rockwell über das neue Potenzial eines alten Materials

Voller Fantasie
Studiobesuch bei Joana Astolfi in Lissabon

Auf ein Neues!
Fünf Architektur- und Designbüros stellen ihren Re-Use-Ansatz vor

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren
Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

„Die Hände haben eine eigene Intelligenz“
Das Berliner Designduo Meyers & Fügmann im Gespräch

Marrakesch, mon amour
Laurence Leenaert von LRNCE interpretiert das marokkanische Handwerk neu

Konzeptionelle Narrative
Studiobesuch bei Lineatur in Berlin

New Kids on the Block
Junge Interior- und Designstudios – Teil 3

„Einfach machen, nicht nachdenken“
Der Designer Frederik Fialin im Gespräch

„Schweizer Design ist knäckebrotmäßig auf die Essenz reduziert!"
Christian Brändle vom Museum für Gestaltung Zürich im Gespräch

Entwürfe für die Neue Wirklichkeit
Ein Interview mit dem Museumsgründer Rafael Horzon

„Wir wollen einen Kokon schaffen“
studioutte aus Mailand im Interview

Berliner Avantgarde
Studiobesuch bei Vaust in Berlin-Schöneberg

Designstar des Nahen Ostens
Hausbesuch bei der libanesischen Gestalterin Nada Debs in Dubai

Cologne Connections
Junge Designer*innen sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 2
