Konstantin Grcic
Ein Gespräch über die vergangenen 20 Jahre

„Ich bin kein großer Stratege.“ Der deutsche Designer Konstantin Grcic erinnert sich an die Zeit um 2000, als er mit Entwürfen wie der Leuchte Mayday oder dem Sessel Chaos seinen eigenen Weg fand. Nach Ausbildung und Studium in Großbritannien hatte er 1991 sein Büro in München gegründet, heute lebt und arbeitet er in Berlin. Ein Gespräch über schöne Zahlen, Jasper Morrison und die größte Überraschung seiner Karriere.
Wenn Sie an die Zeit um das Jahr 2000 denken, welche Projekte waren damals wichtig? In der Vorbereitung auf dieses Gespräch musste ich erst einmal auf meiner Webseite nachschauen. Aus dem Kopf hätte ich die Projekte nicht datieren können. (lacht) 1999 sind die Leuchte Mayday für Flos und das Regal Es für Moormann auf den Markt gekommen, 2001 der Sessel Chaos für Classicon – alles drei sehr wichtige Projekte. In der Rückschau kann ich sagen, dass meine Arbeit in dieser Zeit eine Reife erlangt hat, nach fast zehn Jahren Selbständigkeit. Alle drei sind sehr persönliche, eigenständige Projekte, durch die ich ein gewisses Selbstbewusstsein gewonnen habe. Sie wirkten befreiend und haben den Weg gewiesen für meine weitere Arbeit.
Wie kam es damals zu diesen Projekten? Wenn ich heute darüber nachdenke, wie diese Projekte entstanden sind, was diese Veränderung in mir selbst ausgelöst hat, dann erinnere ich mich an eine gewisse Unzufriedenheit. Auch heute noch komme ich immer wieder an so einen Punkt. Endlich die Dinge machen, die ich gerne machen möchte, zu denen ich aber nie komme. Es läuft doch so: Über Jahre entwickelt man sich in eine bestimmte Richtung, man bekommt Briefings, arbeitet mit bestimmten Firmen zusammen. Irgendwann stellt sich bei mir dann das Verlangen ein, aus dieser Komfortzone auszubrechen und mich selbst herauszufordern. Alle drei Projekte stehen für so einen Moment, Chaos vielleicht am radikalsten. Für Classicon hatte ich bis dahin sehr stark mit der Referenz auf die bestehende Kollektion gearbeitet. Chaos hat dann einen eigenständigen Pflock eingehauen in diese Zusammenarbeit, kurz danach kamen die Tische Diana und Pallas, ebenfalls wichtige Projekte. Das war offensichtlich eine wirklich gute Zeit damals!

Von Designerinnen und Designern habe ich schon öfter gehört, dass es etwa zehn Jahre braucht, um sich eine gewisse Unabhängigkeit zu erarbeiten, finanziell wie ästhetisch. Ich erinnere mich noch genau an die Zeit am Royal College in London: Wir hatten alle keine Ahnung, wie es danach weitergehen würde. Es hieß, es dauere fünf Jahre, dann hätte man das Gröbste geschafft als Selbständiger. Es zeigte sich, dass die allerersten Jahre ziemlich leicht waren. Egal was kam, jedes Projekt, jeder Kunde, es war alles gut, man hatte keine Ansprüche. Und die eigene Struktur war klein, die Fixkosten gering. Die zweiten fünf Jahre wurden dann kompliziert, die Struktur war teurer und schwerfälliger. Ich würde das auch heute noch, unter ganz veränderten Bedingungen, jedem Anfänger mit auf den Weg geben: Es dauert in etwa zehn Jahre. Mein Eindruck ist, dass die jungen Designer heute ungeduldiger sind. Das hat natürlich viel mit den medialen Möglichkeiten zu tun. Du kannst als Nobody ein tolles Rendering an Dezeen schicken, es wird publiziert, und du denkst, du hast es geschafft. Das gab es damals nicht, niemand hat in Frage gestellt, dass die Karriere nur in kleinen Schritten gehen würde.
Gab es für Sie noch andere wichtige Partner oder Kollegen? In dieser Zeit war der Kunststoffhersteller Authentics für mich sehr wichtig. Ich habe mich damals bewusst Industriedesigner genannt und wollte das auch sein. Mit Authentics konnte ich meine ersten richtigen Industriedesignprojekte realisieren, Produkte wie der Papierkorb Square oder der Wäschekorb 2 Hands. Mit dem Gründer von Authentics, Hansjerg Maier-Aichen, habe ich mich auf Anhieb gut verstanden. Wir haben uns genau im richtigen Moment kennengelernt: Seine Firma wuchs, er brauchte jemanden an seiner Seite. Und das wollte ich gerne sein, damit war ich das erste Mal in eine Firma eingebunden. Etwa in die Entwicklung der Kollektion. Ich habe für Authentics Messestände und Ausstellungen in Mailand und Paris entworfen. Es war ein übergreifendes Arbeiten, es ging nicht nur um das einzelne Produkt. Es ging darum, eine eigene Bildsprache zu erfinden.
Gab es Vorbilder für Sie? Ich lerne viel und am besten von Vorbildern. Bis heute ist das italienische Nachkriegsdesign die wichtigste Referenz für mich, die bekannten Namen aus dieser Zeit, ihre Art zu arbeiten. Die Büros waren klein, die Designer arbeiteten langfristig und eng mit bestimmten Firmen zusammen. Sie waren keine Strategen und Marketing gab es schon gar nicht. Trotzdem haben sie die Unternehmen geprägt und ihnen ein Gesicht gegeben. Die Beziehung zwischen Unternehmer, Designer und auch Handwerker, das ist ein Modell, das ich mochte. Und dann gab es natürlich Jasper Morrison, den ich schon vom Studium in England kannte. Später habe ich auch für ihn gearbeitet. Jasper ist nicht viel älter als ich, er war als Vorbild also nicht larger than life. Sein Werdegang hatte einen Bezug zu meinem eigenen Leben, ich dachte, in zehn Jahren könnte ich auch in etwa so arbeiten. Jasper war außerdem sehr kollegial und hilfreich, er hat in dieser Zeit viele Kontakte gestiftet, zu Cappellini natürlich und zu Flos und Magis.
Wie war die Stimmung in der Szene? Die Achtzigerjahre waren eine Designexplosion, in den Neunzigerjahren kam dann die Rückbesinnung auf die Industrie und das kommerzielle Arbeiten. Das Jahr 2000 war die Verheißung der Zukunft. Das lag sicher auch an der schönen Zahl 2000. Die hat Projektionen freigesetzt, jeder hat sich einen extra Kick gegeben. Die Stimmung war optimistisch und offen. Man wog zwar Risiken ab, aber entschied: Das machen wir jetzt einfach. Die Dinge mussten sich nach 2000 anfühlen.

Wie haben Sie damals im Büro gearbeitet? Wie waren die Prozesse, welche Werkzeuge wurden eingesetzt, wie wurde recherchiert? Wir haben viel mit physischen Modellen gearbeitet, mit Mock-ups. Die Zeit um 2000 war der letzte Moment, bevor der Computer zum unersetzlichen Werkzeug wurde. Ich habe immer schon gerne Bücher gekauft und damit gearbeitet. Aber recherchiert haben wir ansonsten eigentlich kaum. (lacht) Aus heutiger Sicht könnte man fragen, ob es gut war, vieles nicht auf dem Radar gehabt zu haben. Wir haben viel mehr als heute in unserer eigenen Welt gearbeitet. Was hätten wir wohl geschafft, hätten wir damals schon Google genutzt? Ich finde es jedenfalls erstaunlich, was wir ohne erreicht haben. Aber ich möchte das auf keinen Fall glorifizieren: Hätten wir andere Werkzeuge gehabt, hätten wir sie auch genutzt.

Der Computer als Entwurfswerkzeug wurde nach 2000 auch zum Thema in einigen Ihrer Entwürfe, beispielsweise beim Sitzmöbel Osorom für Moroso (2002). Das war der Zeitgeist, eine Stimmung, die in der Luft lag. Bei dem Projekt für Moroso ging es um 3D-Druck, es war eines der ersten Objekte, das aus Computerdaten dreidimensional gedruckt wurde. Wir gehörten zu den Pionieren. Deswegen war der Zugang auch total direkt und ungefiltert – einfach mal ausprobieren. Damals hat Stefan Diez bei mir im Büro gearbeitet. Wir haben uns das Ziel gesetzt: ein Objekt entwerfen, das man anders als mit 3D-Druck nicht herstellen könnte. Nur darum ging es uns. Wenn wir mit Holz arbeiten, fragen wir: Welches Holz, welche Verbindung, wie kann man das zusammenleimen? Bei Metall und Kunststoff genauso, man muss immer in der Machbarkeit des Materials denken. Der 3D-Drucker dagegen ist dumm, der macht alles, was du ihm sagst.
Welche Entwurfsthemen war noch relevant? Der Computer wurde in dieser Zeit zwar unersetzlich, aber wir haben ihn nur als Werkzeug benutzt. Wir wollten ihm nicht die Hoheit über das Design überlassen, sondern haben nach wie vor unsere Pappmodelle gebaut. Deswegen ist die kantige Formensprache aus dieser Zeit auch nicht etwa Ausdruck einer futuristischen Idee – das kam von den Modellen. Die ersten Modelle einer Idee waren oft vereinfacht, sehr flächig und kantig. Die Annahme war, dass die Formen im Prozess dann immer weicher und schöner würden. Wurden sie aber nicht. (lacht) Wir fanden es richtig so, wie es war. Ein gutes Beispiel dafür sind Chaos und Mars für Classicon und natürlich auch der Stuhl Chair One für Magis.
Ein anderes Thema war die Aneignung. Ja, das entstand aus der Erfahrung mit der Mayday-Leuchte. Die Mayday ist zunächst einmal ein abstraktes Objekt, weil sie keine herkömmliche Leuchtentypologie abbildet. Aber sie verfügt über Elemente, die jeder sofort versteht: der Haken etwa, der deutlich sichtbare Schalter und dann die zwei Spitzen, an denen man das Kabel aufwickelt. Die Leuchte wirkt wie eine Aufforderung. Nimm mich einfach in die Hand und probiere aus, was du mit mir machen kannst. Für meine Designhaltung war das prägend. Heute ist mir das stets bewusst, die Kommunikation, die von einem Objekt ausgeht, je nachdem, wie man es gestaltet.

Wenn Sie zurückschauen, hätten Sie gerne etwas anders gemacht in Ihrer Karriere? Natürlich könnte man manches anders machen. Aber fatale Fehler habe ich mir glaube ich nicht geleistet. Ich habe einen guten Instinkt dafür, was ich kann und was nicht. Kann bedeutet nicht nur, dass ich lediglich das mache, was ich schon kann. Es bedeutet auch, etwas erreichen zu können, obwohl ich noch nicht weiß, wie ich dahin komme. Dieser Instinkt hat mich ganz gut geführt, wie eine Kompassnadel. Ich bin kein großer Stratege, ich hatte nie den echten Plan.
Womit haben Sie sich selbst überrascht – etwas, was Sie sich nie zugetraut hätten? Sehr viele Jahre meiner Karriere stand die Arbeit absolut im Zentrum meines Lebens. Alles war darum herum gebaut. Mittlerweile habe ich eine Familie – und ein Familienleben beansprucht sehr viel Zeit, man muss sich einlassen. Das habe ich mir lange nicht zugetraut. Es hat mich überrascht, wie einfach das doch geht. Wie man Arbeit und Familie doch zusammenbringen kann. Wie das vieles freisetzt und der Arbeit nicht im Wege steht.

Lange galten Sie als Workaholic, morgens der erste und abends der letzte im Büro, und auch sonntags am Schreibtisch. Damals waren das Büro und meine Mitarbeiter auch meine Familie. Es gibt Fotos, etwa wenn wir irgendwo eine Ausstellung aufgebauten, da sehen wir ein bisschen aus wie eine Rockband, die einen Gig vorbereitet. Das hat total Spaß gemacht, das war mir damals wichtig. Heute ist das anders, und das ist gut so.
Wenn wir über Ihren persönlichen Kontext hinaus schauen, wie hat sich die Designbranche verändert in den vergangenen 20 Jahren? Etwa wenn es um das Bild als Medium der Vermittlung von Design geht? Memphis als einflussreiche Strömung in den Achtzigerjahren hat bereits hauptsächlich über Bilder funktioniert. Aber das waren Bilder von echten Dingen, die es wirklich gab. In den 2000ern erreichten wir eine neue Stufe dieser Entwicklung: Es gab Bilder, aber die Dinge darauf nicht mehr. Zum Beispiel in der Arbeit von Ora ïto, der als junger Designer fiktive Designprojekte am Computer entwickelt hat für große Marken wie Louis Vuitton und Apple. Diese Bilder wurden so stark, dass die Leute diese Objekte wirklich haben wollten. Danach setzte eine ernüchternde und frustrierende Entwicklung ein. Während Projekte wie die von Ora ïto Fiktionen waren, die mehr sein wollten als das Bekannte, wurde das Design nun brav, so schön gefällig und dekorativ. Unsere Welt war kompliziert genug, da sollten sich die Objekte unkompliziert einfügen.
Welche Phänomene im zeitgenössischen Design stimmen Sie hoffnungsvoll? Das Selbermachen! Junge Designer gründen ein eigenes Unternehmen, entwerfen Produkte, produzieren und vertreiben sie auch selbst. Aus dieser Haltung sind einige spannende Projekte entstanden. Es ist aber noch zu früh, dieses Phänomen abschließend zu bewerten. Ich frage mich nur, was das für die Industrie bedeutet? Als Designer war die Industrie immer mein Bezugspunkt. Die Industrie nicht als Feind, sondern als Partner, mit dem zusammen man mehr erreichen kann. Daran glaube ich immer noch. Eine Hoffnung liegt darin, dass die junge Generation und die Industrie zusammenfinden und daraus etwas Interessantes entsteht. Ich denke, die Industrie kann von der jungen unternehmerischen Generation lernen, unkonventionell zu sein, die Dinge mal anders auffassen. Umgekehrt hat die Industrie so viel Potenzial, die Erfahrung, das Kapital, die Technologie und auch unternehmerischer Kultur und Geschichte. Wenn das zusammenkommen könnte, das wäre toll.
Aber müsste sich nicht grundsätzlich etwas ändern im Verhältnis von Industrie und Gestaltern? Gerade jüngere Designer beklagen, dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Die Einnahmen aus den Lizenzen sind zu niedrig, weil Produkte schwer in den Markt zu bringen sind. Die Hersteller werfen sie zu früh wieder aus dem Portfolio, außerdem gibt es zu viele Produkte. Da gebe ich Ihnen recht, es muss sich etwas ändern in diesem Verhältnis. Schon meine Generation hätte daran etwas ändern müssen. Ich glaube auch nicht, dass man sich dem System einfach unterordnen soll, denn ich sehe die Fehler. Die Jungen sollen ruhig Bedingungen stellen.
Dieser Artikel ist Teil des Dossiers: 2000-2020: 20 Jahre Interior & Design
Mehr Menschen
Experimentelle Grenzgängerin
Linde Burkhardt im Berliner Bröhan Museum

„Gerade die Struktur ermöglicht Freiheit“
Warum das modulare Prinzip von USM bis heute relevant ist

Alchemist des Alltags
Wie der Designer Harry Nuriev Vertrautes neu inszeniert

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“
Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Deutsch-Amerikanische Freundschaft
Studiobesuch bei Ester Bruzkus und Peter Greenberg in Berlin

Das Leichte und das Schwere
Die außergewöhnlichen Bauwerke des Architekten Christian Tonko

Tapeten, die bleiben
Felicitas Erfurt-Gordon über nachhaltige und wohngesunde Produkte von Erfurt & Sohn
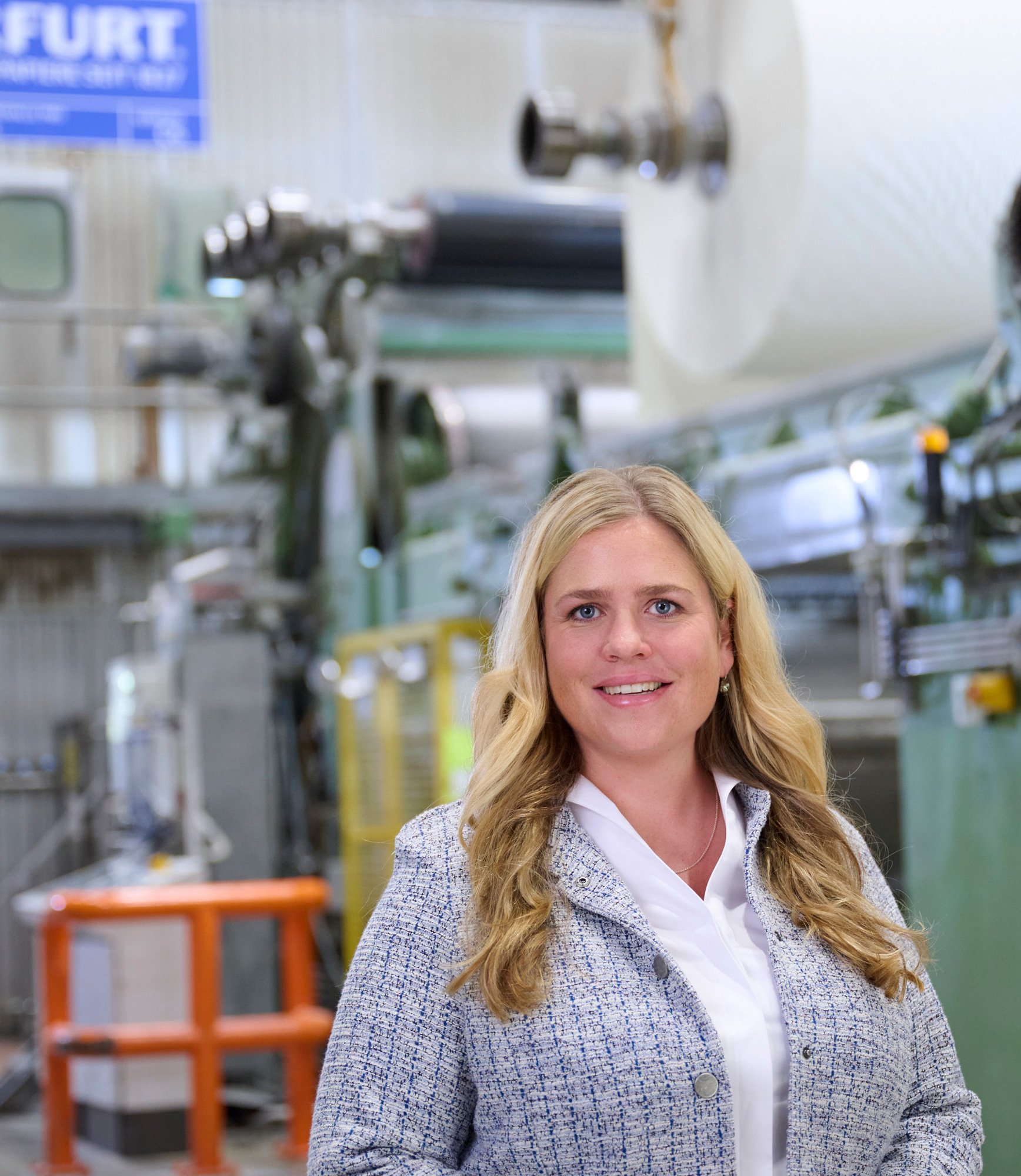
New Kids on the Block
Junge Gestalter*innen erobern die Designwelt

Wut in Kreativität verwandelt
Interview mit der ukrainischen Gestalterin Victoria Yakusha

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“
Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Gemeinsam weiterkommen
Designkollektive auf der Vienna Design Week 2025

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“
Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Experimentierfreude und Nachhaltigkeit
Interview mit dem italienischen Gestalter Harry Thaler

Gespür für innere Logik
Interview mit dem niederländischen Designduo Julia Dozsa und Jan van Dalfsen

Ganzheitliche Gestaltung
Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

Handmade in Marseille
Studiobesuch bei Sarah Espeute von Œuvres Sensibles

Welt aus Kork
Der New Yorker Architekt David Rockwell über das neue Potenzial eines alten Materials

Voller Fantasie
Studiobesuch bei Joana Astolfi in Lissabon

Auf ein Neues!
Fünf Architektur- und Designbüros stellen ihren Re-Use-Ansatz vor

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren
Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

„Die Hände haben eine eigene Intelligenz“
Das Berliner Designduo Meyers & Fügmann im Gespräch

Marrakesch, mon amour
Laurence Leenaert von LRNCE interpretiert das marokkanische Handwerk neu

Konzeptionelle Narrative
Studiobesuch bei Lineatur in Berlin

New Kids on the Block
Junge Interior- und Designstudios – Teil 3

„Einfach machen, nicht nachdenken“
Der Designer Frederik Fialin im Gespräch

„Schweizer Design ist knäckebrotmäßig auf die Essenz reduziert!"
Christian Brändle vom Museum für Gestaltung Zürich im Gespräch

Entwürfe für die Neue Wirklichkeit
Ein Interview mit dem Museumsgründer Rafael Horzon

„Wir wollen einen Kokon schaffen“
studioutte aus Mailand im Interview

Berliner Avantgarde
Studiobesuch bei Vaust in Berlin-Schöneberg

Designstar des Nahen Ostens
Hausbesuch bei der libanesischen Gestalterin Nada Debs in Dubai
